

CRISPR-Cas9 bei Pflanzen
"Ethische Fragen spielen keine Rolle"
Forschung & Lehre: Herr Professor Weigel, Sie wenden das CRISPR-Cas9-Verfahren bei Pflanzen an. Viele Menschen fürchten, dass Forscherinnen und Forscher wie Sie die Folgen dieser Technik nicht ausreichend einschätzen können – können Sie diese beruhigen?
Detlef Weigel: Ja und Nein. Natürlich kann eine Mutation unvorhergesehene Folgen haben, aber das gilt sowohl für natürliche Mutationen als auch für Mutationen, die auf das Genom-Editieren zurückgehen. Bei diesem Verfahren beschleunigen wir nur das, was in der Natur ohnehin andauernd stattfindet: Wir erzeugen Mutationen, kleine Veränderungen im Erbgut, dem Genom. Wenn wir Mutationen fürchten und diese ausschließen wollten, müssten wir jeden Anbau von Pflanzen verbieten, denn auch ohne Züchtung treten spontan im Genom jeder einzelnen Pflanze in jeder Generation neue Mutationen auf. Vor allem bei Nutzpflanzen, die in sehr großer Zahl angebaut werden, wird statistisch gesehen jede einzelne Position des Erbguts in jeder Anbausaison mutiert. Darüber hinaus treten natürliche Mutationen wesentlich häufiger auf, als Forscher sie durch Genom-Editieren hervorrufen. Um die Ähnlichkeit zu spontanen Mutationen zu betonen, verwende ich oft den Begriff der gezielten Mutagenese anstatt des Genom-Editierens, da bei beidem DNA zuerst beschädigt und dann von der Maschinerie der Zelle wieder repariert wird. Erfolgt die Reparatur fehlerhaft, ergibt sich eine Mutation.

F&L: Zusätzlich zu unvorhergesehenen Folgen nach einem erfolgreichen Einsatz von CRISPR-Cas9 kommt es bei der Genom-Editierung immer wieder zu verfehlten Eingriffen, sogenannten off-target Ereignissen, Fehlschüssen, die zu Mutationen an unbeabsichtigten Stellen im Genom führen. Mit welchen Folgen haben Sie in Ihrer Forschungsarbeit schon einmal danebengeschossen?
Detlef Weigel: In den CRISPR-Cas9 mutagenisierten Pflanzen, die wir hergestellt haben, haben wir bislang keine Veränderungen im Genom außerhalb der von uns angestrebten Bereiche nachweisen können. Insgesamt gibt es bislang bei Pflanzen nur wenige konkrete Hinweise, dass solche off-target Ereignisse regelmäßig vorkommen. Und selbst wenn sie aufträten, wären diese von spontanen Mutationen nicht zu unterscheiden, und daher ginge von diesen keine konkrete Gefahr aus. Trotzdem wäre es interessant, mehr darüber zu lernen, wie oft und mit welchen Folgen Mutationen an off-targets vorkommen.
F&L: Sie sprechen von "keiner konkreten Gefahr" – welche typischen Folgen haben Mutagenesen bei Pflanzen?
Detlef Weigel: Wilde Pflanzen, aber auch einige Nutzpflanzen, produzieren Stoffe, die für Menschen oder Tiere schädlich sind. Ein Beispiel ist das leicht giftige Solanin bei Kartoffeln oder Tomaten. Durch spontane Mutationen könnten durchaus Veränderungen entstehen, die dazu führen, dass der Solaningehalt steigt und Tomaten oder Kartoffeln unbekömmlicher werden. Ein Züchter hätte keinerlei Grund, entsprechende Mutationen durch Genom-Editieren auszulösen. Insofern sind gezielte Mutationen wesentlich ungefährlicher als natürliche, ungezielte Mutationen.
F&L: Warum halten Sie Genom-Editierung für unverzichtbar?
Detlef Weigel: Aufgrund des genannten Aspekts: Durch das Genom-Editieren, die gezielte Mutagenese, kann man die Auswirkungen einzelner genetischer Veränderungen viel schneller und gezielter testen. Bei der konventionellen Züchtung muss man Sorten kreuzen, die sich durch Hunderttausende, oder gar Millionen, von natürlichen Mutationen im Genom unterscheiden, auch wenn man nur ein einziges Gen von einer Sorte in eine andere überführen will. Man muss dann aufwändig durch ständige Rückkreuzung all die ungewollten Mutationen wieder entfernen. Durch Genom-Editieren ist es viel einfacher, nur eine einzige Veränderung im Genom einzuführen, was die Züchtung enorm beschleunigt. Für die ökologische und Evolutionsforschung bietet das Genom-Editieren ebenfalls ein großes Potenzial, weil wir ganz gezielt die Auswirkung einzelner Mutationen auf die Fitness von wilden Pflanzen prüfen können. Meine Arbeitsgruppe interessiert zum Beispiel, wie sich wilde Pflanzen an die Umwelt anpassen. Nehmen wir an, ich habe eine Mutation in einer schwedischen Pflanze gefunden, die das Wachstum dort verbessert. Durch Genom-Editieren kann ich diese Mutation jetzt in viele andere Sorten einfügen, um zu testen, ob der positive Effekt unabhängig vom genetischen Hintergrund ist oder ob er auch von anderen Genen im Genom beeinflusst wird.
F&L: Kartoffelchips sollen weniger schädliches Acrylamid und Weizenprodukte weniger Gluten enthalten, Tomaten auf ein bestimmtes Reifedatum festgelegt werden – was hat das noch mit Natürlichkeit zu tun?
Detlef Weigel: Nichts, denn Züchtung an sich ist nicht natürlich. Das bedeutet zum einen, dass entsprechend veränderte wilde Pflanzen anschließend oft weniger fit in der Natur wären. Zum anderen bedeutet es für uns, dass wir von entsprechenden Veränderungen in Nutzpflanzen häufig Vorteile haben: Die Vorgänger unserer Früchte und Gemüse zeichnen sich oft durch Bitterkeit oder übermäßige Säure aus – ich bin froh, dass die Züchtung diese Eigenschaften entfernt hat.
Züchtung funktioniert nun mal so, dass wir Eigenschaften auswählen, die wir besonders gut finden – unabhängig davon, ob solche Eigenschaften natürlich sind oder nicht. Alle Kulturpflanzen, die wir essen, sind nicht mehr natürlich. Das ist nichts Neues.
F&L: Sie fordern, dass durch CRISPR-Cas9 behandelte Pflanzen nicht als gentechnisch verändert im Sinne des Gentechnikgesetzes gekennzeichnet werden sollen, weil man den Eingriff durch diese Methode nach Abschluss nicht mehr feststellen kann – dennoch hat der Eingriff stattgefunden. Wie rechtfertigen Sie, diesen einfach außen vor zu lassen?
Detlef Weigel: In der Tat argumentieren manche, dass nicht nur das Produkt, sondern auch der Prozess der Entstehung berücksichtigt werden muss. Das ist sicherlich richtig, wenn es um ethisch bedenkliche Vorgänge geht. Im Falle des Genom-Editierens bei Pflanzen spielen aus meiner Sicht ethische Fragen jedoch keine Rolle. Bei der Frage, ob eine Pflanze unter das Gentechnikgesetz fällt, sollte folglich nur zählen, ob eine Pflanze fremde DNA enthält. Tut sie das nachweislich nicht, dann sollte das Gentechnikgesetz keine Anwendung finden. Diese Frage ist relevant, da man beim Genom-Editieren von Pflanzen das CRISPR-Cas9 System oft vorübergehend über Transgene, also durch Gentechnik, einführt. Das Transgen kann aber sofort durch einfache Kreuzung wieder entfernt werden.
F&L: Welche sind die wichtigsten Fragen, die hinsichtlich des Einsatzes von CRISPR-Cas9 bei Pflanzen noch geklärt werden müssen?
Detlef Weigel: Eine Frage ist, wie wir mit off-targets umgehen sollten. Wie ich ausgeführt habe, bergen sie meiner Meinung nach kein erhebliches Risiko, auch wenn ihre Häufigkeit noch genauer analysiert werden sollte, damit der Züchter nicht am Ende mit einer Sorte dasteht, die nicht so gut wie gehofft ist. Eine andere pragmatische Frage ist, welchen Maßstab man anlegen sollte, um zu beweisen, dass eine Pflanze keine Fremd-DNA mehr enthält. Ich bin der Meinung, dass die Genom-Sequenzierung ein probates Mittel ist, also die Bestimmung von Veränderungen im gesamten Genom einer Pflanze. Auch muss noch diskutiert werden, wie wir mit der Möglichkeit umgehen, über einfache Mutationen hinausgehende Veränderungen einzuführen, zum Beispiel, wenn wir Gene aus weit entfernt verwandten Arten austauschen.

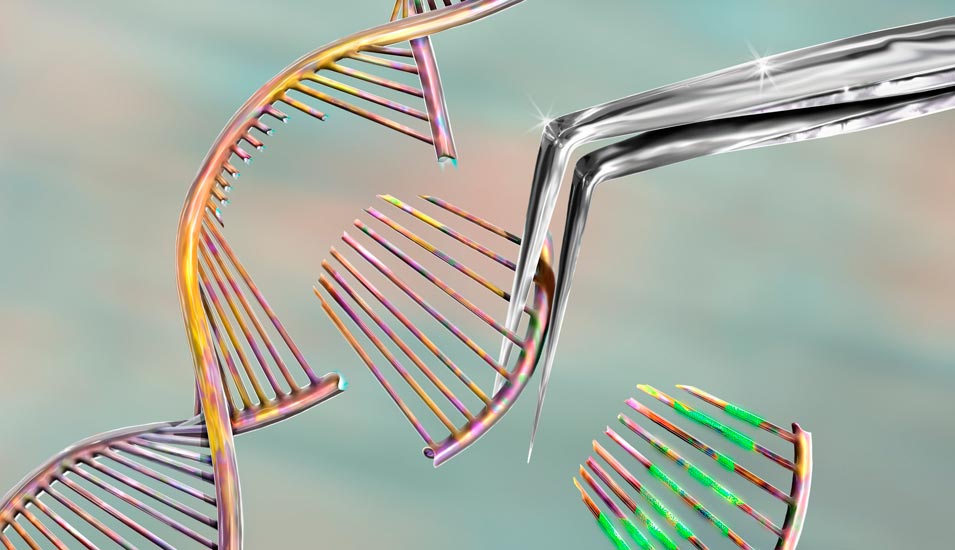
0 Kommentare