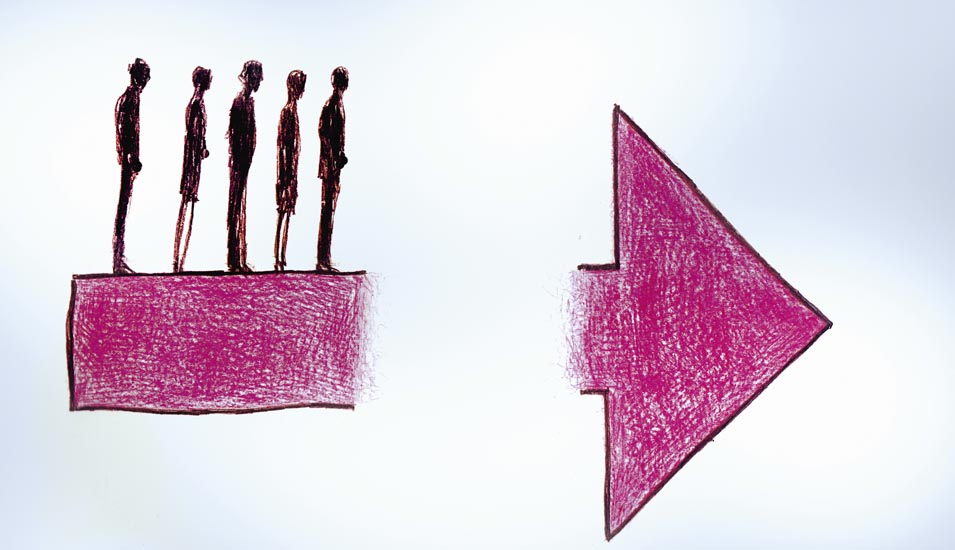
Wissenschaft als Beruf
Das richtige Maß von Risiko und Sicherheit
"Ob es einem … Assistenten jemals gelingt, in die Stelle eines vollen Ordinarius und gar eines Institutsvorstandes einzurücken, ist eine Angelegenheit, die einfach Hazard ist. Gewiß: nicht nur der Zufall herrscht, aber er herrscht doch in ungewöhnlich hohem Grade."
Das stammt nicht von mir, sondern – Sie wissen es längst – von dem großen Max Weber. In seinem 1919 veröffentlichten Vortrag "Wissenschaft als Beruf" stellt Weber den deutschen Qualifikationswegen das amerikanische Modell des Assistant Professor gegenüber und meint:
"Unser deutsches Universita?tsleben amerikanisiert sich, wie unser Leben überhaupt, in sehr wichtigen Punkten, und diese Entwicklung, das bin ich überzeugt, wird weiter übergreifen …"
Da klingt keine Resignation und keine Enttäuschung mit, Befund und Prognose sind im nüchternen Duktus des Sozialwissenschaftlers vorgetragen. Und Weber hat Recht behalten: Ja, das Übergreifen der amerikanischen Verhältnisse auf unsere allgemeinen Lebensverhältnisse hat in ungeahntem Ausmaß stattgefunden und ereignet sich immer noch und immerzu, wobei längst nicht alles überall auf Begeisterung trifft.
Aber gleichzeitig hat sich der Gelehrte auch geirrt:
Die Amerikanisierung der deutschen Universität ist ausgeblieben, jedenfalls was die Qualifikationswege des wissenschaftlichen Nachwuchses angeht.
"Im großen Qualifikations-Hazard gibt es gerade in der letzten Zeit viel zu viele Verlierer." Bernhard Kempen
In den letzten knapp 100 Jahren hat sich bei den Qualifikationswegen nicht allzu viel getan. Noch immer herrscht der Zufall, die Qualifikation ist ein schwer kalkulierbares Risiko. Im großen Qualifikations-Hazard gibt es gerade in der letzten Zeit viel zu viele Verlierer, für die ein neuer, schrecklicher Begriff salonfähig geworden ist: Wissenschaftsprekariat.
Nun ließe sich einwenden, dass Schicksal und Zufall in anderen wettbewerblich geprägten Berufswelten noch viel dramatischer ihre Hand im Spiel haben, denken Sie an Banker, Musiker, Fußballer, Atomkraftwerksbetreiber oder auch an die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Drogeriemarkt- und Kaufhausketten.
Für diese Berufstätigen und für noch viele andere wäre in der Tat schwer nachvollziehbar, dass Wissenschaft als Beruf ein aus ihren Steuermitteln finanziertes lebenslanges Rundum-Sorglos-Paket für jeden Wissenschaftsneuling ist, während sie selbst schneller als gedacht auf der Straße stehen.
Aber auch diesen Berufstätigen wird einleuchten, dass es richtig und wichtig ist, überflüssige und gesamtgesellschaftlich schädliche Risiken vom wissenschaftlichen Nachwuchs fern zu halten. Es ist nun einmal eine immense Vergeudung von Ressourcen und eine individuell nicht zu tragende Härte, wenn von zehn Habilitierten nur drei eine Professur erhalten, und wenn diese drei zudem noch zu voller selbstständiger Arbeit erst in einem Lebensalter antreten, in dem andere schon über den Vorruhestand oder die Altersteilzeit nachzudenken beginnen.
Es geht mit anderen Worten um das richtige Maß von Risiko und Sicherheit. Wenn wir darin einig sind, dass wir mit Blick auf konkurrierende Systeme jenseits des Atlantiks und in Übersee attraktivere Qualifikationswege für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen und gleichzeitig den angedeuteten Missständen entgegenwirken wollen, wenn wir ferner darin einig sind, dass die Idee des beruflichen Qualifikationswettbewerbs nicht grundsätzlich falsch ist und dass berufliche Mobilität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dem Gesamtsystem gut tut, dann müssen wir nach meiner Überzeugung und der Überzeugung des Präsidiums und des Erweiterten Präsidiums des Deutschen Hochschulverbandes folgendes tun:
Wir müssen differenzieren zwischen Qualifikationswegen, die zur Professur führen und Karrierewegen in der Universität, die nicht zur Professur, aber sehr wohl zu Dauerbeschäftigungsverhältnissen führen.
Die qualifikationswilligen Post-Docs müssen wir von einer dienstrechtlichen Abhängigkeit freistellen und sie zugleich Mentoren überantworten, die sie auf dem Weg zur abschließenden Höchstqualifikation begleiten.
In einem größeren Umfang als bisher müssen wir für die Qualifikationswilligen von Tenure-track-Optionen Gebrauch machen. Das ist die eine, strukturelle Seite. Es gibt aber auch noch eine politisch-finanzielle Seite, die mindestens genau so wichtig ist.
An den deutschen Hochschulen sind zur Zeit 140.000 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz überwiegend auf befristeten Stellen beschäftigt. Das ist eine Rekordzahl, und dafür gibt es eine Erklärung, nämlich die vielen Exzellenzprojekte, die von der Exzellenzinitiative angestoßen und finanziert wurden.
Die Perspektiven für die meist hoch qualifizierten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz konkret und schnell zu verbessern, ist das Gebot der Stunde. Hier sind die Länder schon aus kompetenziellen Gründen zu allererst gefordert. Wir werden nicht so schnell vergessen, dass sie – rühmliche Ausnahmen wie Rheinland-Pfalz bestätigen die Regel – die frei gewordenen BAföG-Millionen nicht in die Grundfinanzierung der Hochschulen gesteckt haben.
Es war eine politische Schweinerei ersten Ranges, dass die Länder im letzten Jahr klipp und klar erklärten, dass sie die durch die Übernahme des Bundes frei gewordenen BAföG-Aufwendungen in Höhe von insgesamt jährlich 1,1 Milliarden Euro an die Hochschulen weiter reichen werden, um sich schon wenige Tage später nicht an diese Erklärung gebunden zu fühlen.
"Die Länder sind in der Pflicht, der Bund aber auch." Bernhard Kempen
Doch Schuldzuweisungen helfen dem wissenschaftlichen Nachwuchs nicht weiter: Die Länder sind in der Pflicht, der Bund aber auch. Ich erlaube mir daher, im Namen einer ganzen Generation von hochqualifizierten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr höflich nachzufragen, ob es nicht eine Überlegung wert sein könnte, mit Bundesmitteln ein ansehnliches Paket von zusätzlichen Professuren zu schnüren, an dem die Länder finanziell beteiligt sind.
7.500 Professuren, die auch der Wissenschaftsrat für erforderlich hält, würden zwar nicht einmal ausreichen, die alte Betreuungsrelation von einem Professor und 60 Studenten aus dem Jahr 2010 wiederherzustellen. Heute haben wir bei einer Rekordsumme von 2,7 Millionen Studierenden eine Betreuungsrelation von 1 zu 64. Aber die zusätzlichen Professuren wären ein Schritt in die richtige Richtung, und vor allem wären sie das längst überfällige Signal an den wissenschaftlichen Nachwuchs: Ihr seid nicht nur Handlanger im Exzellenzgeschäft von Eliteuniversitäten und solchen, die es werden wollen, sondern ihr habt eine dauerhafte Zukunft in der Universität.
Ich bin zuversichtlich, dass die Diskussion um die Zukunft der Pakte Gelegenheit bieten wird, sich des wissenschaftlichen Nachwuchses zu erinnern. Einen Namen für die zusätzlichen Professuren hätte ich schon: die Wanka-Professuren. Nun muss Frau Ministerin Wanka nur noch das Geld dafür bereit stellen.
Gekürzte Fassung des Eröffnungsvortrages zum 65. DHV-Tag in Mainz am 24. März 2015