

Wissenschaftlicher Werdegang
Wie soziale Klugheit die Karriere prägt
Als ich gegenüber meinem Doktorvater zum ersten Mal erwähnte, eine akademische Karriere in Erwägung zu ziehen, sah er mich an und fragte: "Ein schöner Plan. Haben Sie denn auch genügend Charakterstärke, nicht zu verbittern, wenn andere, die schlechter sind, an Ihnen vorbeiziehen?" Die Frage überraschte mich. Sie zielte nicht auf die äußeren Voraussetzungen des Erfolgs – Noten, Publikationslisten, Erfahrungen –, sondern auf die inneren Folgen des Scheiterns.
"Haben Sie denn auch genügend Charakterstärke, nicht zu verbittern, wenn andere, die schlechter sind, an Ihnen vorbeiziehen?"
Das ist vielleicht der falsche Weg, um Personen, die nicht sehr von sich überzeugt sind, in einem Vorsatz zu bestärken, aber es ist der richtige Weg, jemanden davon abzubringen, der nicht von sich überzeugt ist. Denn diese Überzeugung ist selbst eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Sie muss aber begleitet sein von dem, was Boxer "Nehmerqualitäten" nennen, der Fähigkeit, Rückschläge einzustecken und aus ihnen zu lernen. Akademische Karrieren klappen selten auf den ersten Versuch, und es ist entscheidend, was die gescheiterten Versuche aus einem machen. Die Enttäuschung darüber, dass die Selbstachtung angesichts der erbrachten Leistungen, der durchgearbeiteten Nächte, der Jahre des Verzichts, nicht sofort von den Berufungskommissionen erwidert wird, kann umschlagen in eine beleidigte Resignation, die sich verkannt fühlt, aber doch noch einmal mitspielt im großen Theater der Bewerbungsverfahren. Eine solche innere Haltung nannte man früher "Privatdozentenkoller", eine klassische self-fulfilling prophecy. Der Bewerber schwitzt sie aus allen Poren, sie verbreitet sich atmosphärisch und verhindert den "guten Eindruck", der letztlich solche Kommissionen überzeugt: zupackender Optimismus mit dem richtigen Maß an Wille und Selbstvertrauen, gekontert durch die Fähigkeit, sich zurücknehmen, einordnen zu können in kooperative Arbeitszusammenhänge. Denn berufen wird am Ende nicht nur die herausragende Wissenschaftlerin, sondern auch die Kollegin.
Die vier Klugheitsregeln der wissenschaftlichen Karriere
Die erste und wichtigste Klugheitsregel bei der akademischen Karriereplanung ist deshalb, dass sich solche Karrieren nicht planen lassen. Sie sind und bleiben ein "Hazard" (Max Weber), trotz aller Versuche der Objektivierung von Qualifikationen und Bewerbungsverfahren, denn Objektivierung läuft in der Praxis auf die Differenzierung von Qualitätskriterien hinaus. Heute reichen nicht mehr die hervorragenden Qualifikationsarbeiten, sie müssen auch in anerkannten Journals publiziert sein, die Menge der Publikationen muss stimmen, ebenso wie die Drittmitteleinwerbungen, und wenn die Bewerber sich in diesen Kriterien nicht mehr unterscheiden, weil alle ihre Karriereplanung danach ausgerichtet haben, wenn also das ewige Gesetz der Kriterieninflation eintritt, kommt vielleicht bald der "Transfer" hinzu. Das ist ein Spiel ohne Ende, und seine Funktion besteht nicht darin, die Auswahl zu versachlichen und damit planbar zu machen, sondern die Entscheidungsspielräume durch Differenzierung zu vergrößern: Je mehr Kriterien in Ausschreibungstexten genannt sind, umso eher können Gutachten und Laudatio durch Gewichtung Entscheidungen rechtfertigen. Dann betont man eben die außergewöhnlich hohen Einwerbesummen an Drittmitteln und verschweigt, dass die akademische Lehrerfahrung eher bescheiden ist. Oder umgekehrt. Dafür müssen die Bewerberinnen aber erst einmal "Munition" liefern. Darum lautet die zweite Klugheitsregel: die gerade angesagten und künftig erwartbaren Bewerbungskriterien bedienen – allerdings in dem Bewusstsein, dass ihre Erfüllung alleine noch nicht den Erfolg garantiert. Siehe erste Regel.
Alle diese Verfahren verlangen ein hohes Maß an Taktgefühl, mit dem zwei Pole der Selbstdarstellung je nach Situation ausbalanciert werden müssen: das Herausstellen der eigenen und die Anerkennung der Leistungen Anderer. Anerkennung ist stets wechselseitig, und die kleinen Ungleichgewichte – das überschießende Lob einer Rednerin bei der Vorstellung, der Anschluss eigener Arbeiten an einen grundlegend innovativen Ansatz, die akademische Laudatio – entfalten wie ein Geschenk, das erwidert werden muss, auf der anderen Seite eine verpflichtende Wirkung. Wer hier stets ein bisschen mehr gibt als nimmt, schafft Verpflichtungswahrscheinlichkeiten.
Auch diese Fähigkeit muss zuerst innerlich vorbereitet werden, und meine dritte Klugheitsregel lautet deshalb: innerlich spät ankommen. Sich immer eine Karrierestufe unterhalb derjenigen fühlen, auf der man tatsächlich ist. Wer sich zu früh aufplustert, wirkt nicht nur unsympathisch, sondern erlaubt es den anderen auch nicht, die eigenen Stärken zu entdecken und hervorzuheben, weil sie darauf konzentriert sind, die überschießenden Geltungsansprüche einzuhegen. Das Lob unter formal Gleichen fällt leichter, wenn es zumindest gefühlt aus der Position des überlegenen Gönners gefällt wird, der reziprok dann wieder auf Gefolgschaft hoffen darf.
Deshalb ist es wichtig, nicht zu übersehen, dass die Rhetorik der Kollegialität und der gleichen Geltung des wissenschaftlichen Arguments sich in einer sozialen Struktur entfaltet, die von Statusunterschieden geprägt ist und trotz der Ausbreitung des Jugendlichkeitskults in der Wissenschaft auch künftig geprägt sein wird. Statusunterschiede können formalen Charakter haben und durch Positionen markiert sein – Dekanin, Direktor, Sprecherin –, häufig genug aber sind sie informell, durch Reputation oder Seniorität gekennzeichnet. Wenn der relativ junge Vortragsredner die Frage eines Emeritus auf den Diskussionsteil verschiebt, weil er zunächst nur Verständnisfragen beantworten möchte, ist das eine Taktlosigkeit gegenüber dem informellen Statusunterschied, die vielleicht eine gnadenlose Kritik am Vortrag nach sich ziehen wird, in jedem Fall aber einen potenziellen Gutachter verstimmt.
Darum lautet meine vierte Klugheitsregel: nicht zu früh aus dem Windschatten treten. Wer den Schlussspurt schon nach der ersten Etappe beginnt, dem kann die Puste ausgehen. Viele Karriereverläufe als Juniorprofessuren zeugen von diesem Dilemma, weil die Anzahl der Anforderungen sich noch in der Karrierephase ausdifferenziert und die Tenure-Kriterienliste wie die formalen Anforderungskriterien in Ausschreibungen wirken. Wer in einer solchen Position übersieht, dass die formale Gleichstellung begleitet wird durch die informalen Statusunterschiede und deshalb auf vertikale Verpflichtungsnetzwerke verzichtet, muss in der wissenschaftlichen Leistung so überzeugend sein, dass die unausgesprochenen Argumente der kollegialen Sympathien ausgestochen werden.
Es ließen sich noch viele weitere Regeln ableiten, die sich alle zu den realen Karriereverläufen verhalten wie die Bauernregeln zum Wetter: Sie können Relevanz entfalten, müssen es aber nicht. Auch durch Klugheitsregeln werden wissenschaftliche Karrieren nicht planbar. Darum lautet die letzte und abschließende Regel: selbst nachdenken, selbst beobachten, reflektieren, entscheiden. Wie im Alltagshandeln.
Literaturtipp
Weber, Max, Wissenschaft als Beruf, (Reclam) Stuttgart 1995

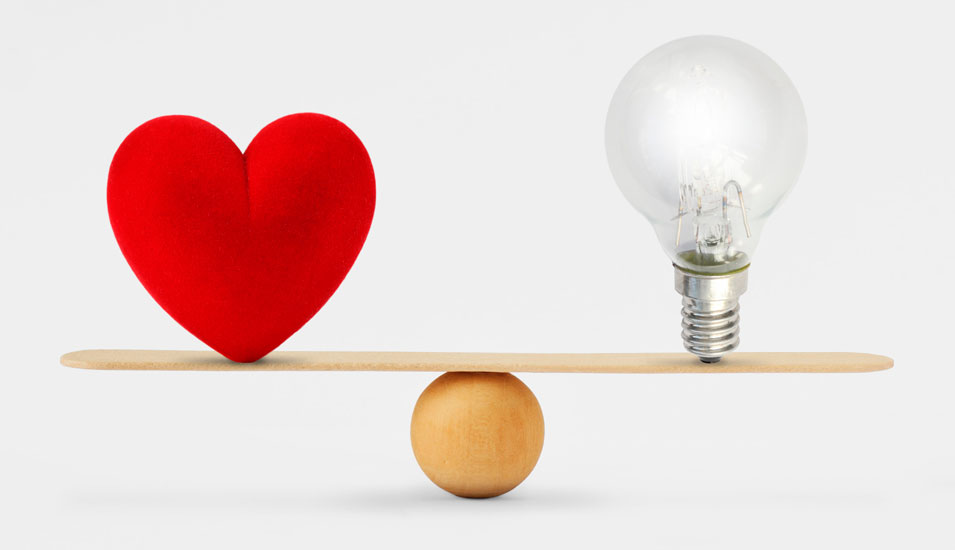

0 Kommentare