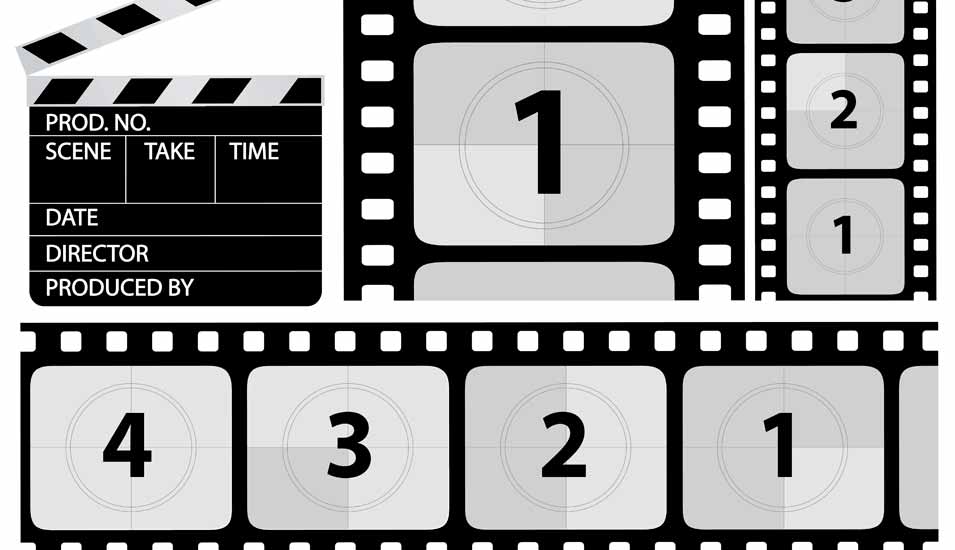Spielfilm zur Wissenschaft
"Nicht ganz so schlimm und noch viel schlimmer"
Forschung & Lehre: Herr Linz, von Viertelstellen über Evaluationsmarathons bis zum Wertverlust von Abschlüssen: "Weitermachen Sanssouci" ist eine Satire über Schattenseiten der Universität. Was hat zur Entscheidung für diesen Film geführt?
Max Linz: Ich wollte die Fragen, die mich in meinem ersten Spielfilm "Ich will mich nicht künstlich aufregen" beschäftigt hatten, weiter bearbeiten. Der Co-Drehbuchautor von "Weitermachen Sanssouci", Dr. Nicolas von Passavant, saß damals an seiner Promotion in der Germanistik. In unseren Gesprächen habe ich immer wieder den Eindruck gewonnen, dass im universitären System ähnliche Prozesse wirken wie in der Kulturproduktion, der ich meinen ersten Film gewidmet hatte. Es herrscht eine vergleichbare Ökonomie, die zu betrüblichen Arbeitsverhältnissen führt. Die wollten wir in einem Unterhaltungsfilm darstellen.
F&L: Was ist das Ihrer Meinung nach für eine Ökonomie?
Max Linz: In beiden Berufen trägt der sogenannte "Nachwuchs" einen großen Anteil dazu bei, dass alles läuft. Zu dieser Gruppe gehört man sehr lange – bis zu einem Alter von rund 40 Jahren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden gewissermaßen gefördert und bewegen sich dabei finanziell auf einem spätstudentischen Niveau. Sie versuchen, ihre eigene Forschung zu entwickeln, haben aber über den Förderrahmen hinaus keine sicheren beruflichen Perspektiven. Die Wahrscheinlichkeit, die erworbenen Qualifikationen später auch einsetzen zu können, ist begrenzt.

F&L: Die Leiterin des im Film vorgestellten Instituts sagt über eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, der sie gerade eine 28 Prozent-Stelle angeboten hat: "Sie war eine dieser hochqualifizierten jungen Leute, bei denen man sich fragte, warum sie nie irgendetwas gegen ihre Situation unternahmen." Was wäre das?
Max Linz: Ich sehe die Verantwortung bei der anderen Seite; bei Personen wie der Professorin im Film, die unbefristete Stellen haben und nicht von den Unsicherheiten im akademischen Mittelbau bedroht sind. Die Universitäten sind jedoch kontinuierlich unterfinanziert, weil ihre Budgets nicht in dem Maße steigen, indem sie es müssten. Das macht die Situation nicht leichter; genau hier müsste man ansetzen. Denn ich würde mir wünschen, dass Führungspersonen an den Hochschulen etwas gegen die aktuelle Situation unternehmen und nicht entgegen der Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen handeln, indem sie das System mittragen, wie es ist. Ein Beispiel dafür ist die Auslegung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, das eine befristete Beschäftigung zeitlich begrenzt. Ich höre immer wieder, dass es für viele etwa unmöglich ist, eine Habilitation in dem gesetzten Zeitraum zu erreichen. Trotzdem unterbieten sich die Hochschuladministrationen noch in ihren Vorgaben.
"Die Realität der Darstellung bleibt für mich entscheidend."
F&L: "Weitermachen Sanssouci" ist ein Spielfilm. Dazu haben Sie einmal gesagt, dass Sie die Realität darin so stark verfremden wollen, dass Sie die nötige Distanz gewinnen, um sich einem Thema wieder nähern zu können. Was macht diese Verfremdung für Sie aus?
Max Linz: Ein Film sollte meines Erachtens dafür sorgen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht das Gefühl haben, dasselbe zu erleben, was sie auch außerhalb des Kinos erleben. Der Film kann eine Realität zeigen, die man zwar wiedererkennt und auf etwas beziehen kann, gleichzeitig bleibt die Realität der Darstellung für mich entscheidend. Denn die Wirklichkeit ist immer zugleich nicht ganz so schlimm wie im Film und noch viel schlimmer.
F&L: Der Film spielt an einem Institut für Kybernetik. Das Forscherteam entwickelt Simulationen zum Klimawandel. Haben Sie sich bewusst für dieses aktuell stark diskutierte Thema entschieden?
Max Linz: Als Kind habe ich spekuliert, dass ich keinen Führerschein brauchen werde, weil dann keine Autos mehr auf den Straßen fahren werden. Mein gesamtes Aufwachsen stand im Zeichen der Klimakrise – mal hatte sie eine größere, mal eine schwächere mediale Öffentlichkeit. Von Aktualität kann man daher nicht sprechen. Das Klimathema hat sich vielmehr organisch ergeben aus meiner Beschäftigung mit der Kybernetik, eine Vorform der Informatik, die ermöglicht, einen Ist-Zustand mit einem Soll-Zustand zu vergleichen. Die Kybernetik ist für die Klimaforschung elementar. Mir hat die Vorstellung zugesagt, den Druck in der Wissenschaft zur gelingenden und überwältigenden Selbstdarstellung mit der Klimasimulation und der mittlerweile herrschenden Hoffnungslosigkeit zu verknüpfen, dass die Politik die Prognosen der Forschung in Regierungshandeln umsetzt. Dafür ist das kürzlich verabschiedete Klimapaket ein gutes Beispiel. Die Erkenntnisse der Kybernetik werden in der Gegenwart genutzt, aber nicht wenn es um die Gestaltung der Zukunft geht.
F&L: Was meinen Sie damit?
Max Linz: Apps sagen uns live, wo gerade Stau ist und welche alternativen Routen wir wählen können oder wo sich ein Bus aktuell befindet, auf den wir warten. Das Aufhalten von Entwicklungen, die unsere Gegenwart gefährden, wird dagegen permanent vertagt. Was übrig bleibt, sind imaginäre Bildwelten davon, was uns bevorsteht, zum Beispiel durch die Klimakrise zerstörte ökologische Welten. Im Film wird daher auch das chilenische Projekt "Cybersyn" aufgegriffen. Die Dozentin diskutiert darüber mit ihren Studierenden. In Chile wurde mit dem Projekt Anfang der 70er Jahre der Versuch unternommen, Regierungshandeln in Echtzeit durch Computer zu ermöglichen.
"Ich bin froh, wenn der Film von denjenigen gesehen wird, die die Lage an den Universitäten zu verantworten haben."
F&L: Wie wichtig ist Ihnen, dass der Film politische Konsequenzen nach sich zieht?
Max Linz: Ich bin froh, wenn der Film von denjenigen gesehen wird, die die Lage an den Universitäten zu verantworten haben und Entscheidungen darüber treffen können, wie Wissenschaft organisiert ist. Doch ich bin skeptisch, dass der Film einen direkten Effekt auf politische Entscheidungen hat. Er verändert wohl kaum die politische Ökonomie, die darüber entscheidet, wie viel Geld für die Bildung ausgegeben wird.
F&L: Wollten Sie auch Menschen erreichen, die keine direkten Berührungspunkte mit dem Arbeitsumfeld Wissenschaft haben?
Max Linz: Ein Spielfilm richtet sich historisch zunächst immer an alle. Er wird nicht mit einer bestimmten Zielgruppe im Kopf gemacht. Das entscheidet sich erst hinterher. Ob man einen Film mit einem begrenzten oder sogar ganz ohne Budget bewerben muss oder ob dahinter ein hochkapitalisiertes und zusätzlich massiv subventioniertes Filmstudio steht, hat den größten Einfluss darauf, welche Menschen ihn letztlich sehen. Erst dadurch wird der Film vielleicht ein Zielgruppenfilm für eine bestimmte Mikroöffentlichkeit.
F&L: Was macht Ihren Film für Nicht-Wissenschaftler interessant?
Max Linz: Inhalt wird überbewertet. Das Kino kennt verschiedene formale Erzähltechniken, zum Beispiel den "Schuss-Gegenschuss". Am Anfang des Films schreibt ein Dozent zum Beispiel eine mathematische Formel an die Tafel, über die Berechnung des ästhetischen Zustands, eine Idee von Max Bense aus den sechziger Jahren. Darauf folgt ein sogenannter "Gegenschuss" auf die Studierenden, die ihn fragend angucken. Dieser Schnitt ist für das Publikum da, damit sie sehen, dass es vollkommen in Ordnung ist, das in diesem Moment nicht zu verstehen.
F&L: Sie haben sich Ihren Film mehrfach im Kino mit angesehen. Wie haben Sie die Reaktionen des Publikums erlebt?
Max Linz: Ich finde es interessant zu sehen, dass keine Vorstellung ist wie die andere. Die ersten Vorführungen bei der Berlinale fanden vor einem Publikum von 500 bis 1.000 Personen statt. Das führte dazu, dass viel mehr gelacht wurde als ich gedacht hatte. Auch ich habe an Stellen gelacht, die ich vorher gar nicht lustig fand. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer waren hinterher enttäuscht, dass der Film zu klamaukig sei. Schauen sie den Film dann noch einmal in einem solide besuchten Programmkino, sehen sie einen völlig anderen Film. Es herrscht plötzlich eine viel nachdenklichere Stimmung als auf dem Festival. Das Publikum spürt, dass der Film trotz allem komödiantischen Kino-Spektakel von der Realität, die er beschreibt, selbst genauso betroffen ist.