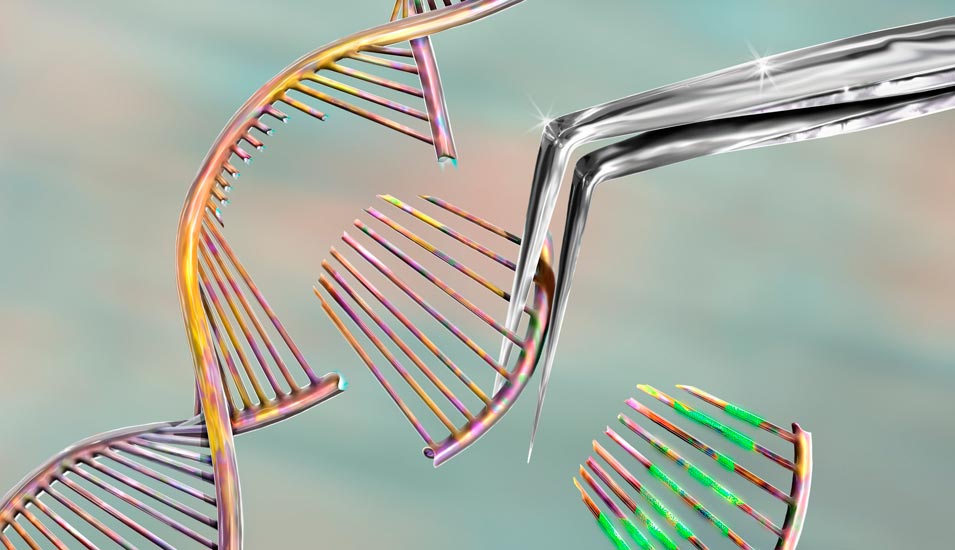
Genom-Editierung
Ethische Reflexionen zur CRISPR-Technologie
Ein Verfahren mit dem "geheimnisvollen" Akronym CRISPR scheint neue Möglichkeiten und unerwartete Chancen zu bieten und zugleich mit kaum kalkulierbaren Risiken und Gefahren verbunden zu sein, die das Chancen- und Risikopotenzial vergleichbarer konventioneller Methoden der Biotechnologie bei Weitem übersteigen. So oder ähnlich könnte man versuchen, den medial bereits inszenierten, aber in der breiten Öffentlichkeit dennoch noch immer kaum bekannten Möglichkeitsraum der Präzisions-Genom-Editierung zu umreißen. Bereits seit der Etablierung der CRISPR-Technologie vor circa zwei Jahren zeichnet sich ein exponentieller Anstieg neuer Forschungsstrategien und -ergebnisse ab, die Forschende Dinge durchführen oder realistisch planen lassen, von denen sie noch vor wenigen Jahren kaum zu träumen wagten.
Potenzielle Anwendungsmöglichkeiten
Im Bereich von Tumorerkrankungen deutet sich ein entscheidender Meilenstein hin zur Präzisionsmedizin an. Die Organknappheit in der Transplantationsmedizin könnte dadurch überwunden werden, dass beispielsweise durch CRISPR- Cas9 veränderte Schweineorgane nicht mehr abgestoßen oder schwerste Nebenwirkungen verursachen würden – es sei denn, man äußert tierethische Bedenken gegen ein solches Verfahren. Aber auch somatische Gentherapien (nicht nur, aber auch) beim Menschen oder gleich Keimbahninterventionen, um schwere Erbkrankheiten zu therapieren oder ihre Entstehung von vornherein zu verhindern (eine Möglichkeit, die aber auch die gezielte Verbesserung der genetischen Ausstattung, das sogenannte Enhancement, am Horizont aufscheinen lässt), stehen auf der biowissenschaftlichen Menükarte. Eingriffe in das Genom von Pflanzen und Tieren erscheinen umsetzbar mit dem Ziel, sie gegen Viren oder Bakterien resistent zu machen oder nervige Plagegeister (wie etwa die das ZIKA-Virus verbreitende Aedes aegypti-Mücke) gleich ganz loszuwerden.
Neben solch potenziellen Anwendungsmöglichkeiten kommt hinzu: Der Grund für die europaweite Ablehnung der sogenannten grünen Gentechnik, nämlich die Einschleusung von Fremdgenen in eine Pflanze, scheint bei den neuen Genom-Editierungsverfahren zumindest prima facie als Begründung wegzufallen: Führt man mithilfe von CRISPR beispielsweise eine Punktmutation am Genom einer Pflanze durch, so lässt sich die Veränderung von solchen, die im Wildtyp passieren können, nicht unterscheiden. Folgt man dem vor allem in Amerika angewandten Ansatz der Produktbewertung von biotechnologischen Eingriffen, wäre der Eingriff im Produkt nicht mehr nachweisbar und entsprechend als besonders präzise, ja sogar verhältnismäßig schonende Züchtungen einzustufen. Wo, wie aktuell (noch) in Europa, allerdings der biotechnologische Prozess im Mittelpunkt der Bewertung steht, ist damit zu rechnen, dass CRISPR-Cas9 und Co-Modifizierungen wie die hier geradezu verwünschten gentechnisch veränderten Organismen (GVO) eingestuft und regulatorisch mit hohen Hürden versehen werden. Für eine weltweit agierende Agrarindustrie stellen solche Regulierungsdifferenzen entscheidende Standortüberlegungen mit womöglich milliardenschweren Konsequenzen dar.
Hält man sich nur diesen kleinen Auszug aus den in Bälde als realistisch umzusetzenden Möglichkeiten von CRISPR-Cas9 vor Augen, kann man pointiert festhalten: Präzisions-Genom-Editierung stellt eine von manchen gar als Revolution bezeichnete biowissenschaftliche Innovation dar, die sich auf leisen Sohlen daherkommend und doch disruptiv anschickt, die Welt, unsere Lebenswelt, radikal zu verändern. Dass solche Veränderungen nicht ohne ethische Reflexion ablaufen sollten, versteht sich geradezu von selbst. Dabei ist per se weder undifferenziertes Bedenkenträgertum noch nachträgliche moralische Weihe schon längst etablierter Verfahren – gemeinhin "Akzeptanzbeschaffung" genannt – die Aufgabe ethischer Reflexion.
Ethische Reflexion
Ethik ist zunächst einmal reflexive Distanznahme zu moralischen Einstellungen gegenüber Handlungen, Entscheidungen und sozialen Arrangements. Deshalb muss es darum gehen zu prüfen, worauf wir uns als Gesellschaft – wer immer "Wir" auch ist – mit Verfahren der Präzisions-Genom-Editierung einlassen oder eben nicht einlassen wollen.
Um diese Aufgabe theoretisch ambitioniert wie praktisch umsetzbar unter den Bedingungen einer forcierten Moderne anzugehen, bedarf es einer mehrdimensionalen Methodologie. Diese schließt zunächst – in den Worten von Rabinow und Bennett – eine sogenannte First-Wave-Abwägung ein: die Beurteilung und Abwägung von Absichten, Chancen und Risiken. Bei solcher Abwägung orientiert sich die Ethik zunächst an der sogenannten Technikfolgenabschätzung und fragt: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und das Schadenspotenzial möglicher Fehler, unbeabsichtigter Freisetzung und im Gegenzug schnell und effektiv wirkender Gegenmaßnahmen einzuschätzen (sogenannte Biosafety-Problematik). Je höher im Fehlermanagement ein nicht hinreichend kalkulierbares oder beherrschbares Restrisiko eingestuft wird, umso höher steigt auch das zusätzliche Risiko für missbräuchliche Verwendung solcher Technologien durch Kriminelle oder gar Terroristen (Biosecurity- und Dual-Use-Problematik). Die Werbebotschaft für CRISPR lautet: Das Verfahren ist proportional zu vergleichbaren Methoden effektiv, effizient, leicht zu lernen, einfach zu handhaben und kostengünstig – ein Versprechen, das nicht nur zum wohlmeinend-friedlichen Gebrauch einlädt! Entsprechende Wege, wie sie unter anderem der Deutsche Ethikrat in seiner Biosicherheitsstellungnahme von 2014 vorgeschlagen hat, sollten verstärkt angegangen werden: Wir müssen für die Wissenschaft an einer (neuen) Sicherheitskultur arbeiten, in deren Rahmen Aufklärung und Selbstverpflichtung der Wissenschaft, die Erarbeitung entsprechender Codes of Conduct und gegebenenfalls die Installierung von Kommissionen adressiert werden können.
Zur Frage des moralischen und rechtlichen Verbots
Über die Technikfolgenabschätzung hinaus stellt sich für nicht wenige die grundsätzliche Frage, ob bestimmte Verwendungen der neuen Gen-Scheren in sich moralisch verwerflich sind oder nicht. Gerade die Frage des moralischen und rechtlichen Verbots der Veränderung der menschlichen Keimbahn hat in den letzten zwei Jahren weltweit eine intensive Debatte heraufbeschworen. Obwohl bei der moralischen Bewertung dieser Frage überraschungsfrei – auch und gerade auf dem internationalen Symposium in Washington Ende 2015 – keine Einigung erzielt wurde, wurde doch in breitester Übereinstimmung konstatiert: Gegenwärtig – und dies bedeutet mindestens für die nächsten fünf Jahre – sind die Risiken einer Keimbahnintervention als so hoch einzustufen, dass kein Kind mit einer solchen Veränderung zur Geburt gebracht werden darf. Die gewonnene Zeit sollte trotz der weltanschaulichen Differenzen genutzt werden, um darüber nachzudenken, ob ein solches De-facto-Moratorium zu vererbbaren Genmanipulationen bei Menschen nicht noch verlängert werden muss. Das in den letzten Jahren gewonnene Wissen um epigenetische Effekte, die erst nach vielen Jahren geklärt werden können, gibt gemäß dem sorgsam einzusetzenden Vorsichtsprinzip Anlass zur weiteren Zurückhaltung gegenüber solchen Humanexperimenten.
Um dabei das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, ist es geboten, das Verfahren der Geneditierung nicht pauschal zu bewerten, sondern unter Berücksichtigung von Kriterien wie Vernetzung, Wahrung von Biodiversität und Rückholbarkeit jeweiliger Verfahren nach Domänen (Mikroorganismus, Pflanze, Tier, Mensch), dem dabei direkt oder indirekt avisierten Komplexitätslevel (Zelle, Gewebe, Organismus), dem intendierten Anwendungskontext (Grundlagenforschung, Forschung und/ oder Anwendung für Medikamente, Nahrungsmittel, Militär) und den beteiligten Akteuren (Privatpersonen, öffentliche Forschung, Industrie, Militär) zu differenzieren.
Selbstreflexivität ethischer Forschung
Um dem Verdacht proaktiv entgegenzutreten, dass die Bewertung neuer Technologien tendenziell downstream, reaktiv und nicht selten akzeptanzbeschaffend vonstattengeht ("informing the public about science"), hat sich über die Bearbeitung der ethischen Kriteriologie hinaus der Ansatz einer sogenannten Second-Wave-Bioethik etabliert. Ziel ist es dabei, ein weiteres (Selbst-)Reflexiv-Werden ethischer Erforschung – allein schon zur Beseitigung der jeweils eigenen blinden Flecke – zu etablieren. Dabei wird postuliert, dass eine solche (Selbst-)Reflexivität der ethischen Begleitforschung dann gelingen kann, wenn im Sinne eines "Up-Streaming-Prozesses" noch vor, spätestens aber bei der Durchführung von Forschungsprojekten – soweit und intensiv wie möglich – das Gespräch mit der Öffentlichkeit transparent und partizipativ gesucht wird ("public engagement with science"). Auf diese Weise möchten die Vertreter dieses Ansatzes kritische Fragen einer Biotechnologie von vornherein mit öffentlich geäußerten Hoffnungen, Erwartungen und Ängsten konfrontieren und den Forschungsentscheidungsprozess aktiver aus einer breiten Öffentlichkeit heraus mitgestalten.
Aus den desaströsen Erfahrungen mit der grünen Gentechnik und umgekehrt ermutigenden Erfahrungen aus dem Bereich der Synthetischen Biologie empfiehlt sich dieses Verfahren für die kommenden Fragestellungen der Präzisions-Genom-Editierung dringend. Sind nämlich Methoden und Begriffe vorurteilsbehaftet verbrannt, erscheint eine spätere Trendwende nahezu unmöglich – eine unbedingt zu vermeidende Gefahr, da damit Innovationen mitunter vorschnell unmöglich würden. Zugleich würde man einem Fehlschluss erliegen, meinte man, man könne allein oder vorwiegend mit Verfahrensstrategien ethische Probleme lösen. Formale Standards sind notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingungen ethischer Reflexionen. Gerade in jüngster Zeit hat das ideale Bild möglichst breiter Partizipation Risse erhalten: Wer bringt sich wie zu Wort? Repräsentieren diejenigen, die Partizipation fordern, relevante Bevölkerungsgruppen oder besonders forsch vorgetragene Partikularinteressen? Umgekehrt gilt aber auch: Ethische Reflexionen bleiben wirkungslos, wenn entsprechende kriteriengeleitete Überlegungen nicht mit rezeptionssensiblen Strategien zusammengedacht werden.
Organisations- und Sozialethik
Um eine solche, nicht nur als window-dressing fungierende Strategie verantwortlicher Governance voranzubringen, ist ein dritter Zweig verantwortungsethischer Reflexion auf der Schwelle von Wissenschaft und Gesellschaft entwickelt worden: Empirische Studien zeigen, dass viele Menschen zwar wissenschaftlichen Fortschritt begrüßen, aber zugleich die hohe Komplexität von Forschungsprozessen kaum nachvollziehen können. Das Vertrauen in die Forschung hat sich daher zu einem nicht unerheblichen Teil auf eine Art Institutionenvertrauen verschoben. Dabei zeigt sich die Tendenz: Öffentlichen Institutionen wird mehr Vertrauen entgegengebracht als privatwirtschaftlich organisierten. Dieses Vertrauen wird häufig wie eine Art Blankoscheck vergeben, bleibt aber prekär, weil es bei Missbrauch oder Skandalen schnell zurückgezogen wird. Ganze Forschungszweige und nicht nur die jeweiligen Übeltäter können davon betroffen sein. Solch verlorenes Vertrauen zurückzuerobern ist schwer, zum Teil aussichtslos.
Was bedeutet dieser Trend für die Ethik von Genom-Editierung? Sage keiner, die Berücksichtigung solcher Beobachtungen sei reine Moralpsychologie oder -soziologie. Nein, Wissenschaftsethik in diesem wie anderen Bereichen emergierender Biotechnologien muss Organisations- und Sozialethik sein, will sie die Herausforderungen des Diskurses zwischen Wissenschaft und diversen Öffentlichkeiten verantwortlich reflektieren und gestalten: Es reicht nicht mehr aus, sich darauf zu konzentrieren, rein inhaltliche Fragen re- und im zweiten bioethischen Ansatz auch proaktiv zu adressieren. Menschen wollen den Eindruck gewinnen, dass die jeweiligen Forschungsinstitutionen von sich aus, quasi ungefragt, ein Kriseninterventionsregime aufgebaut haben, das im Notfall eingreifen kann. Wenn auf Nachfrage oder im Ernstfall solches Engagement nachweisbar ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das an sich brüchige Institutionenvertrauen einbricht. Verschiedene Beispiele zeigen das Gegenteil: Es kann gegebenenfalls sogar durch die jeweilige Krise hindurch gestärkt werden.
Nur wenn die Ethik der Präzisions-Genom-Editierung alle drei Dimensionen von Ethik berücksichtigt und kultiviert, wird es gelingen, diese vielversprechende, aber auch mit immensen Risiken behaftete Biotechnologie mit dem nötigen Vertrauen und der gebotenen Skepsis zu begleiten. Den Einsatz dieser Technik grundsätzlich scheitern zu lassen, wäre jedenfalls unverantwortlich. Angesichts des enormen Potenzials gibt es eben auch nicht nur eine Schuld, wenn man gefährliche Dinge tut, sondern auch, wenn man angesichts drängender globaler Herausforderungen sinnvolle Lösungsansätze vorschnell unterlässt.