
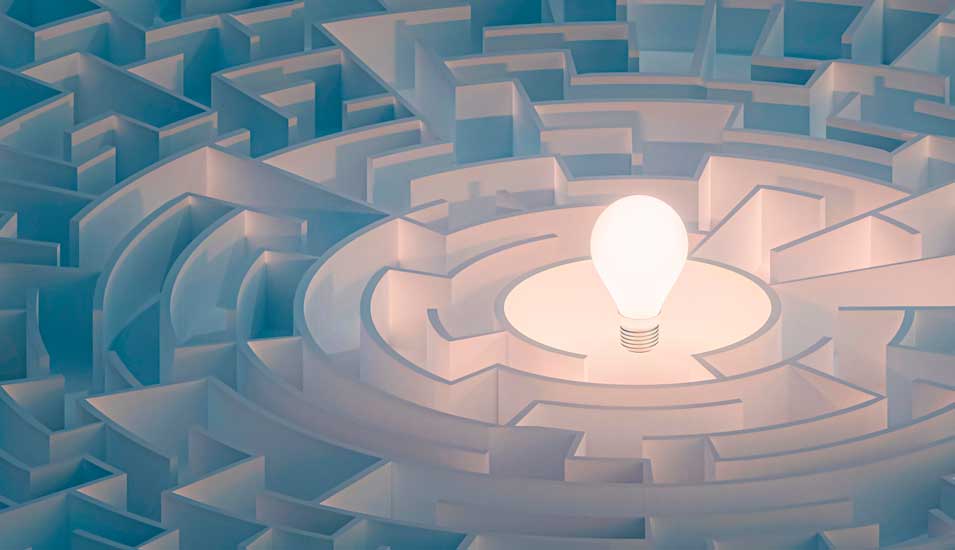
Intelligenzforschung
Menschliche Intelligenz und ihre Messung
Mit der Umsetzung der allgemeinen Schulpflicht mussten sich Gesellschaften neuen Realitäten stellen: Viele Kinder, deren Eltern Analphabeten waren, lernten mühelos lesen, schreiben und rechnen. Es konnte den Lehrern nicht entgehen, dass sich manches Kind aus einfachsten Verhältnissen sehr viel leichter mit dem Lernen tat als ein Kind aus privilegierten Ständen. Gleichzeitig gab es auch Kinder, die offensichtlich nicht in der Lage waren, die angebotenen schulischen Lerngelegenheiten sinnvoll zu nutzen. Daraus ergaben sich zwei grundlegende Erkenntnisse, die die wissenschaftliche Intelligenzforschung bis heute prägen. Erstens kann man die Unterschiede im geistigen Potential nicht allein mit Unterschieden im Förderpotential der Umwelt erklären. Zweitens braucht es anregende Lerngelegenheiten, damit sich das kognitive Potential von Menschen in seiner ganzen Breite entfalten kann.
Die großen Unterschiede in der Lernfähigkeit von Kindern warfen praktische Probleme auf und verlangten nach wissenschaftlichen Erklärungen. Gesellschaftliche Veränderungen in der Bildungs- und Arbeitswelt erforderten Prognosen zum zukünftigen geistigen Potential von Menschen. Man musste auf der Basis bestehender und messbarer Kompetenzen möglichst zuverlässig vorhersagen, wie gut jemand eine zukünftige Anforderung bewältigen werde, für die noch kein Wissen vorliegt.
Auf dem Weg zum Intelligenzquotienten
Seitdem sich vor fast 150 Jahren die Psychologie als eigenständige Wissenschaft etabliert hat, gehört die Erforschung und Erklärung von Intelligenzunterschieden zu den zentralen Teildisziplinen. Der Franzose Alfred Binet (1857-1911) kreierte die ersten Intelligenzaufgaben, welche auf schlussfolgerndes Denken abzielten. Bei dem Engländer Francis Galton (1822-1911) standen Unterschiede in der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit im Mittelpunkt, die in statistischen Kennzahlen abgebildet wurden.
Der Deutsche Wilhelm Ludwig Stern (1871-1938) entwickelte ein statistisches Maß zur Abbildung von Intelligenz in der Kindheit und im Jugendalter: Für jede Altersstufe errechnete er, wie viele Aufgaben eines Tests im Durchschnitt gelöst wurden. Das war der Referenzwert: Ein sechsjähriges Kind, das so viele Aufgaben lösen konnte wie ein durchschnittliches achtjähriges Kind, ist offensichtlich weit überdurchschnittlich intelligent. Ein Intelligenzalter von 8 dividiert durch ein Lebensalter von 6 ergibt 1,33. Da wir Menschen besser mit natürlichen Zahlen umgehen können, multiplizierte Stern diesen Wert mit 100, und kam so auf einen Intelligenzquotienten (IQ) von 133.
Diese Berechnung ist nur für die Lebensspanne sinnvoll, in der die Entwicklung der geistigen Leistungsfähigkeit mit dem zunehmenden Lebensalter Schritt hält, was bereits in der Adoleszenz nicht mehr der Fall ist. Geblieben ist aber Sterns Vorschlag eines Referenzwerts von 100 für den mittleren IQ sowie die grundlegende Idee, wonach die Messung der Intelligenz durch die Abweichung von diesem Mittelwert definiert ist. Anders als bei Merkmalen wie der Körpergrösse gibt es beim IQ keinen absoluten Nullpunkt und keine externe Referenzgrösse: Die Einheit, in der Intelligenz gemessen wird, ist die Standardabweichung vom Mittelwert der Stichprobe, an der der Test normiert wurde. Dieses seit 100 Jahren übliche Vorgehen hat sich auf der Grundlage von Sterns Überlegungen etabliert, und wurde dann vom amerikanischen Psychologen David Wechsler (1896-1981) zum heutigen Abweichungs-IQ weiterentwickelt.
Genetische Anlagen von Intelligenz
Nach wie vor aktuell ist auch das Verständnis von Intelligenz, die Stern beschrieb als "die allgemeine Fähigkeit eines Individuums, sein Denken bewusst auf neue Forderungen einzustellen; sie ist allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens". Seit mehr als 100 Jahren bilden Aufgaben zum schlussfolgernden Denken den Kern der Intelligenztests: Aus bestehendem Wissen muss unter Zeitdruck durch logisches Schlussfolgern neues Wissen generiert werden. Die Aufgaben basieren auf sprachlich, bildlich oder numerisch vermittelter Information und setzen voraus, dass man mit diesen Darstellungsweisen vertraut ist. Deshalb steigt die Zuverlässigkeit, mit der man die Intelligenz messen kann, wenn die zu Testenden eine Schule besucht haben. Die Dauer des Schulbesuchs beeinflusst ebenfalls den Intelligenzquotienten, den eine Person erreichen kann.
Dass Intelligenzunterschiede, die man in einer Gruppe von Menschen findet, die eine vergleichbare kognitive Förderung erfahren haben, auf Genvariationen zurückzuführen sind, ist in der Psychologie seit langem unbestritten. Genetische Unterschiede treten zutage, wenn Menschen die Gelegenheit bekommen, ihre geistige Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Die Intelligenz eines Menschen entsteht also, indem eine große Anzahl von Genen und deren Variationen durch eine geistig fordernde Umwelt zum Einsatz kommen. Selbst wenn es eines Tages gelingen sollte – wovon wir derzeit noch meilenweit entfernt sind – alle Genorte zu lokalisieren und die Genvariationen zu identifizieren, die zur Intelligenz beitragen, könnte man aus der DNA eines Menschen nicht zuverlässig auf seine Intelligenz schließen, da diese sich aus der Interaktion von Genen und Umwelt entwickelt. Die große Zahl von Genen und ihren Variationen, von denen zudem angenommen wird, dass sie sich über alle Chromosomen verteilen, erklärt auch die Variation der Intelligenz innerhalb von Familien. Bei der Meiose (Reifeteilung) und der Befruchtung findet eine große Genlotterie statt, die die Ausprägung eines komplexen Merkmals wie Intelligenz nicht eindeutig berechenbar macht.
Intelligenztests können gesamtgesellschaftlichen Nutzen haben
Internationale Studien zeigen, dass die Leistung in Intelligenztests den Berufs- und Lebenserfolg gut vorhersagen kann. Intelligente Menschen sind innovativ, können Risiken besser abwägen und komplexe Zusammenhänge durchschauen. Intelligente Kinder und Jugendliche in bildungsfernen Milieus zu entdecken, bleibt eine große Herausforderung, der wir uns nicht nur aus Gründen der Chancengerechtigkeit stellen müssen, sondern auch aus gesamtgesellschaftlichen Gründen. Gelingt es einer Gesellschaft, das Potenzial besonders intelligenter Menschen zu nutzen, kann sich die Lebensqualität für alle verbessern. Vor diesem Hintergrund sind die wegweisenden Arbeiten Wilhelm Ludwig Sterns von größter Aktualität. Setzt sich nämlich die in entwickelten Ländern in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende Tendenz fort, wonach in vielen Fällen eher die soziale Herkunft als die Intelligenz den Bildungsweg von Kindern und Jugendlichen bestimmt, wird dies nicht ohne Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft bleiben. Verantwortungsvolle Positionen müssten dann mit Menschen besetzt werden, die zwar das Bildungssystem durchlaufen haben, aber nicht ausreichend in der Lage sind, ihr "Denken bewusst auf neue Forderungen einzustellen", um mit Wilhelm Ludwig Stern zu sprechen.
Der Einsatz von Intelligenztests, die seit Binet, Galton und Stern kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert wurden, kann dem entgegenwirken. Trotz aller Versuche, den traditionellen Intelligenzbegriff zu diskreditieren, indem beispielsweise weitere angeblich wichtigere Intelligenzen erfunden wurden (beispielsweise soziale oder emotionale), bleiben Tests zum schlussfolgernden Denken die zuverlässigste Methode zur Vorhersage von beruflichen Leistungen. Die Messgenauigkeit von Intelligenztests ist nicht perfekt, gehört aber zu den besten aller psychologischen Messverfahren. Bei Bildungsentscheidungen spielen Intelligenztests in Europa jedoch bisher – außer bei der Zuweisung auf Förderschulen – nur in wenigen Ländern eine Rolle. Wenn wir in Zukunft Intelligenz stärker als eine Ressource für gesamtgesellschaftliche Lebensqualität nutzen wollen, muss diese einen größeren Stellenwert beim Zugang zur Universität und den darauf vorbereitenden Schulformen wie dem Gymnasium bekommen. Idealerweise sollten Intelligenztests von Anfang an Teil des Bildungsmonitorings sein. Damit können fehlende Passungen zwischen kognitiven Begabungen und Bildungsentscheidungen vermieden werden. Eine Universitätsausbildung, die ihren Namen verdient, setzt nun einmal eine überdurchschnittliche Intelligenz voraus. Mit Intelligenztests hat die Gesellschaft die Möglichkeit, junge Menschen zum Zug kommen zu lassen, die diese Voraussetzung erfüllen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.
Wilhelm Ludwig Stern selbst musste 1933 nicht nur mit ansehen, wie intelligente Menschen an deutschen Universitäten vertrieben wurden, sondern war als Jude selbst davon betroffen. Dank internationaler Kontakte konnte er als William Louis Stern rechtzeitig in die USA auswandern.
Literatur
Stern, William. Die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung und deren Anwendung an Schulkindern. Leipzig: J. A. Barth, 1912.
Stern, Elsbeth und Neubauer, Aljoscha. Intelligenz. Große Unterschiede und ihre Folgen. München: Deutsche Verlags Anstalt, 2013.

