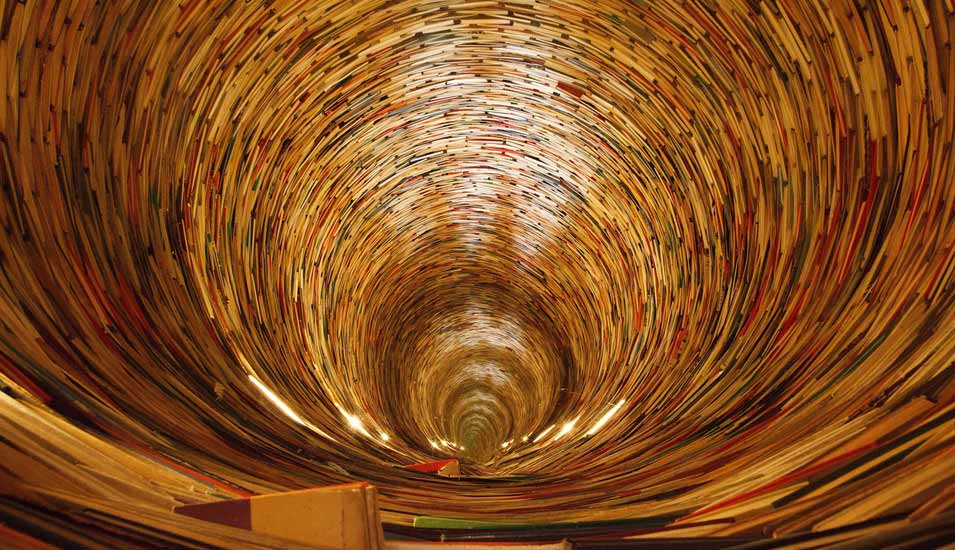Wissenschaftliche Karriere
Der Wert einer Publikation
Neben dem Zwang zur Einwerbung von Drittmitteln und zur Internationalisierung besteht die Gefahr, dass die ökonomisierte Universität die persönliche Lebenszeit ihrer Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler entwertet. Befristete Arbeitsverträge in Teilzeit, terminlich höchst ambitionierte Forschungsdesigns und freiwillige Lehrverpflichtungsübernahmen von abhängig Beschäftigten werden schleichend zur Normalität.
Ein weiterer Faktor erhöht den Druck: Entscheidend für individuelle Karrierefortschritte in der Wissenschaft ist unter anderem der Publikations-Output. In jüngerer Zeit hat insbesondere für kumulativ angelegte Qualifizierungsvorhaben das Modell des Open Access stark an Bedeutung gewonnen. Diese Veröffentlichungsform ist für die Medienanbieter ökonomisch lukrativ und wird zudem verbreitet als transparente wissenschaftliche Praxis angesehen.
Allerdings wurden zuletzt zunehmend Fragen danach laut, ob Verlage, die sich durch Open Access profilieren, angesichts der enormen Publikationszahlen in regelmäßig erscheinenden Zeitschriften und Sonderheften überhaupt noch grundlegende wissenschaftliche Prinzipien garantieren können. Kritiker sehen – im Hinblick auf den Druck auf die Gutachter, die extrem eng getakteten Begutachtungsprozesse, die grundsätzliche Möglichkeit, Gutachten zurückzuhalten und die Steuerung des gesamten Prozesses durch fachlich unzureichend qualifizierte Editoren – ein Indiz dafür, dass ökonomische Motive (in Einzelfällen?) bereits die Oberhand über die wissenschaftliche Qualität der Publikationen gewonnen haben.
Wenn sich eine Autorin oder ein Autor nicht darauf verlassen kann, dass die Ergebnisse und Texte in angemessener Zeit gründlich und fachkundig begutachtet werden, sind Peer-Review-Verfahren und hohe Publikationsgebühren von zum Teil vielen Tausend Euro obsolet.
Schnelle Review-Verfahren und hohe Impact Factors
In forschungsbezogenen und universitären Bewerbungsverfahren spielen ungeachtet der offenkundig pekuniär bedingten Problematiken unverändert die bloße Anzahl von Publikationen und deren Impact Factor eine entscheidende Rolle. Anfang 2023 verlor eine der größten Zeitschriften der Welt ("International Journal of Environmental Research and Public Health") ihren Eintrag im Web of Science und damit formal ihren Impact Factor.
Offiziell wurde dies damit begründet, dass Artikel außerhalb der originären Themenbereiche der Zeitschrift veröffentlicht worden seien. Vermutlich die Folge zu schnell durchgeführter Review-Verfahren oder nicht ausreichend qualifizierter Editoren. Die betreffende Zeitschrift kämpft seitdem mit einem massiven Imageverlust. Ein solcher Vorgang kann für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sehr konkrete und im Einzelfall sogar katastrophale Folgen haben.
Wenn sie zum Beispiel bei einer solchen Zeitschrift eines ihrer für die Promotion notwendigen Paper veröffentlicht hatten, stünde das entsprechende Paper dann formal mit solchen Veröffentlichungen auf einer Stufe, die aus ganz anderen – und möglicherweise gravierenderen – Gründen in einer nicht im Web of Science gelisteten Zeitschrift veröffentlicht wurden. Und das, obwohl das entsprechende Paper mit größter Sorgfalt und allen Gütekriterien genügend angefertigt wurde.
Die Entscheidung für speziell diese Zeitschrift fiel möglicherweise wegen des verlockend schnellen Review-Verfahrens und des vergleichsweise hohen Impact Factors. Musste die Promovendin beziehungsweise der Promovend vor dem Hintergrund eines ablaufenden Arbeitsvertrags entscheiden, ob ein schnelles Review-Verfahren zu riskant sein könnte und solide Arbeit besser ist? Oder hätte sie beziehungsweise er gar den Zusammenbruch der ganzen Zeitschrift antizipieren müssen? Ist es diese Gewissensentscheidung zwischen (zugespitzt formuliert) guten Karrierechancen einerseits und guter wissenschaftlicher Praxis andererseits, die wir dem Nachwuchs neben allen weiteren Belastungen zumuten möchten?
"Die Entscheidung für speziell diese Zeitschrift fiel möglicherweise wegen des verlockend schnellen Review-Verfahrens und des vergleichsweise hohen Impact Factors."
DORA: Alternative oder leeres Versprechen?
Vor dem Hintergrund einer drohenden Entwertung solcher wissenschaftlichen Publikationen verpflichten sich zunehmend Universitäten und andere Forschungseinrichtungen zur "San Francisco Declaration on Research Assessment" (DORA). Diese Erklärung fordert einerseits die Abkehr von der rein quantitativen Bewertung wissenschaftlichen Outputs, wie zum Beispiel der Orientierung am Impact Factor oder der reinen Zahl an Publikationen. Gleichzeitig liefert DORA konkrete Alternativen, um die mehrdimensionale Bewertung wissenschaftlicher Leistung zu ermöglichen.
Eine relativierte Bedeutung der reinen Anzahl von Publikationen und eines hohen Impact Factors würde in der Realität tatsächlich einen Teil der Last von den Schultern des Nachwuchses nehmen und gleichzeitig den Fokus auf die Qualität der einzelnen Veröffentlichungen legen. In vielen Fällen scheint die Selbstverpflichtung zu den Grundsätzen der DORA und die damit verbundene Abkehr von quantitativ-numerischen Parametern in der Praxis häufig leider nicht mehr als ein leeres Versprechen zu bleiben.
Sowohl die Realität an den wissenschaftlichen Einrichtungen als auch die Forschung hierzu legen nahe, dass in den meisten Fällen nach wie vor quantitative Kennzahlen über Erfolg und Misserfolg einer wissenschaftlichen Karriere bestimmen – auch an solchen Einrichtungen, die sich offiziell zur DORA bekannt haben.
Themen-Schwerpunkt "Publizieren"
Alles, was die Wissenschaft rund um das Thema "Publikationen" bewegt, erfahren Sie in unserem Themen-Schwerpunkt "Publizieren".
Den Druck verringern: schützend vor die Schwächsten stellen
Das aktuelle Wissenschaftssystem weist viele Merkmale auf, die bei allem Idealismus nicht kurz- oder mittelfristig lösbar sind, zum Beispiel die Abhängigkeit von Drittmitteln, die fast immer zu befristeten Arbeitsverträgen führt. Eine zeitliche Entlastung der Promovierenden ist in dieser Hinsicht daher nur bedingt möglich. Würde man aber den Anspruch der DORA als Universität, Forschungsgemeinschaft oder Fakultät wirklich ernst nehmen, könnte dies den Druck, der von quantitativen Kennzahlen wie der Anzahl an Publikationen oder deren Impact Factor ausgeht, zumindest verringern.
Gleichzeitig würde sich das Dilemma der Promovierenden auflösen, zwischen eigenen Karrierechancen und den Idealen einer Wissenschaft, die frei ist von ökonomischen Einflüssen, wählen zu müssen. Oft ist von einer "wissenschaftlichen Gemeinschaft" die Rede. Der Ursprung des Wortes "Gemeinschaft" – eine Gruppe von Menschen, die dieselben Werte teilen und ein gemeinsames Ziel verfolgen – impliziert, dass alle in der Wissenschaft Tätigen an einem Strang ziehen, unabhängig von ihrer jeweiligen Erfahrung und ihrer hierarchischen Stellung im System.
Die großen Institutionen des Systems sollten den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Teil ihrer Last abnehmen, indem sie sich zu ihren selbst auferlegten (und in Teilen medial selbstbewusst inszenierten) Prinzipien wie der DORA bekennen und sich somit im Sinne einer echten Gemeinschaft schützend vor ihre Schwächsten stellen.