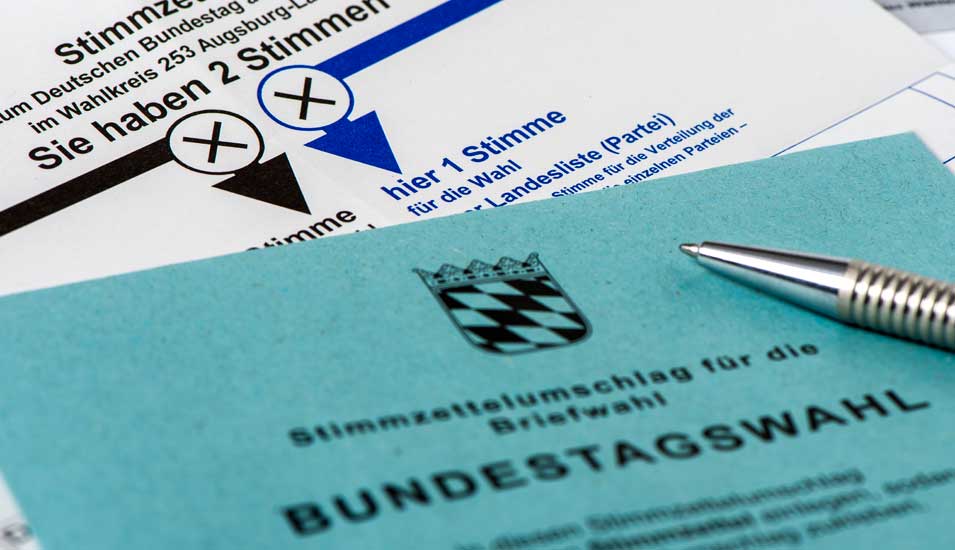Kommunikation per Social Media
Tweet-Stil von Politikern beeinflusst Wähler
Soziale Medien wie Twitter, Facebook und Instagram sind inzwischen in der Politik etabliert. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker nutzen sie für eine direkte Ansprache der Bürgerinnen und Bürger. Die Inhalte, die sie dort teilen, können beeinflussen, wie sie von den Wählerinnen und Wählern wahrgenommen werden. Politische Beiträge tragen zu einer professionelleren Wahrnehmung bei, während sich zu viele private Inhalte negativ auswirken können. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Forschenden aus der Schweiz und den Niederlanden.
Die Forschenden der Universitäten Basel, Genf, Tilburg und Amsterdam untersuchten unterschiedliche Kommunikationsstrategien auf Twitter. Dafür zeigten sie über 4.300 Personen aus der Schweiz und Deutschland Twitter-Profile von fiktiven Politikerinnen und Politikern und befragten sie zu ihrem Eindruck. Ihr Ergebnis: Je deutlicher und spezifischer der politische Inhalt war, desto besser kam ein Tweet bei den Befragten an. Rein private Tweets lehnten die Befragten hingegen eher ab.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Studienteilnehmenden die Politikerin oder den Politiker wählen würden, sei zudem höher gewesen, wenn diese spezifische und weniger spezifische politische Tweets kombinierten und wenn sie auf Kommentare von Usern eingingen. "Der Social Media-Stil eines Volksvertreters kann demnach für eine Wahl durchaus relevant sein", erklärte Professorin Stefanie Bailer, Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Studie.
ckr