

Reflexion
Zur wirtschaftlichen Lage der Klinika
Im universitären Fächerverbund besitzt die Medizin eine Besonderheit: Sie ist für Zwecke von Forschung und Lehre eng mit den Universitätsklinika verknüpft. Diese sind in eigener Rechtsform organisierte wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Universitätsklinika werden nicht primär aus Haushaltsmitteln der Länder oder Forschungsdrittmitteln finanziert, sondern erwirtschaften ihre Erlöse über die Patientenversorgung. Dabei stehen sie im intensiven Wettbewerb mit anderen Krankenhäusern.
Der Jahresumsatz eines Universitätsklinikums liegt in der Regel im höheren dreistelligen Millionenbereich, in Einzelfällen sogar im Milliardenbereich. In der Medizin machen daher die Krankenversorgungserlöse im Durchschnitt mit circa 75 Prozent das Gros des Gesamtbudgets von Klinikum und Fakultät aus. Aus dem Landeszuschuss für Forschung und Lehre und Forschungsdrittmitteln kommen circa 25 Prozent, spezifisch für diese akademischen Aufgaben.
Forschung, Lehre und Krankenversorgung bilden in der Medizin ein Amalgam. Deshalb sind die Budgets der Universitätsklinika und der Medizinfakultäten an vielen Stellen eng verflochten. Über Trennungsrechnungen wird zwar versucht, möglichst verursachungsgerecht zu budgetieren. Dies stößt jedoch an vielen Stellen an methodische und praktische Grenzen. Faktisch lassen sich die Budgets von Fakultät und Klinikum nicht völlig entkoppeln.
DRG-Fallpauschalensystem problematisch
Angesichts des großen Anteils der Krankenversorgung am Gesamtbudget muss die wirtschaftliche Stabilität des Klinikums eine sehr hohe Priorität für alle Verantwortlichen in der Universitätsmedizin haben. Rote Zahlen im Klinikum führen in der Regel zu Konsolidierungsanstrengungen, bei denen die Effizienz des Klinikbetriebs im Vordergrund steht.
Friktionen mit den Bedürfnissen von Forschung und Lehre sind dabei angesichts der in der Praxis nicht trennbaren Forschungs- und Krankenversorgungsprozesse nicht immer zu vermeiden. Daher bleibt eine wirtschaftliche Schieflage des Klinikums auf Dauer nicht ohne Folgen für die Fakultät und damit letztlich auch die akademische Leistungsfähigkeit des jeweiligen Standorts.
Allerdings sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Universitätsklinika seit vielen Jahren schwierig. Schwarze Zahlen sind zunehmend nur noch mit erheblicher Kraftanstrengung aller Beteiligten zu erreichen. Hohe Priorität hat dabei die möglichst hohe Auslastung des Klinikums.
Die Budgets sind derart knapp bemessen, dass sofort das Jahresergebnis in Gefahr gerät, wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht. Eine mehrwöchige Stilllegung von OP-Sälen infolge eines Wasserschadens, ein Keimausbruch auf der Intensivstation oder ein Streik in wichtigen Funktionsbereichen reichen heute bereits aus, um ein Universitätsklinikum wirtschaftlich in Bedrängnis zu bringen. Gleiches gilt für einen überdurchschnittlichen Tarifabschluss.
"Die Universitätsklinika wurden ohne jede Differenzierung in diesen Wettbewerbsmarkt einbezogen." Ralf Heyder und Frank Wissing
Die Gründe dafür liegen in der unzureichenden Investitionsfinanzierung der Länder und in gesundheitspolitischen Weichenstellungen bei der Betriebskostenfinanzierung Anfang des Jahrtausends. Damals wurde das DRG-Fallpauschalensystem eingeführt, das die Entgelte für die stationäre Patientenversorgung und damit das Gros des Klinikbudgets regelt.
Das Fallpauschalen-System sollte den Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern befeuern. Geld sollte nur noch fließen, wenn Leistungen für Patienten erbracht werden. Seither wird reine Vorhaltung von Infrastrukturen, zum Beispiel für Notfälle, nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen finanziert. Betten und OP-Säle, die nicht maximal ausgelastet sind, sind in einem solchen System ein wirtschaftliches Problem.
Zudem wurden die Fallpauschalen als Einheitspreissystem eingeführt. Für die Patientenbehandlung bekommen alle Krankenhäuser bei einer gegebenen Diagnose (Erkrankung) oder Prozedur (zum Beispiel ein operativer Eingriff) das gleiche Entgelt, unabhängig davon, ob sie Fachklinik, Grundversorgungshaus, Maximalversorger oder Universitätsklinikum sind.
Der Preis wird jeweils als Durchschnittspreis aus den Kostendaten einer großen Stichprobe von Krankenhäusern berechnet. Die Idee dabei: Kliniken, die überdurchschnittlich gut wirtschaften, bspw. indem sie ihre Patienten überdurchschnittlich früh entlassen, sollen belohnt werden. Alle anderen müssen entweder ihre Effizienz steigern, aus dem Markt ausscheiden oder von ihren Trägern subventioniert werden.
Dieser rein leistungsbezogene "Einheitspreis"-Ansatz ist ein deutscher Sonderweg. Andere Länder, die ebenfalls Fallpauschalensysteme für die Krankenhausfinanzierung nutzen, berücksichtigen bei der Budgetermittlung viel stärker die regionalen und strukturellen Besonderheiten der einzelnen Krankenhäuser. In Deutschland dagegen wollte man einen möglichst intensiven Wettbewerb um Effizienz.
Steigender Wettbewerb in der Krankenversorgung
Die mit diesem Finanzierungssystem verbundene gesundheitspolitische Hoffnung war, dass es in dem von Überkapazitäten (das heißt, zu viele Standorte, zu viele Betten) geprägten deutschen Krankenhausmarkt zu einer Marktbereinigung kommen würde. Über 15 Jahre nach der Einführung hat sich diese Erwartung jedoch nicht ansatzweise erfüllt.
Die Universitätsklinika, die etwa zehn Prozent der akut-stationären Patienten in Deutschland versorgen, wurden ohne jede Differenzierung in diesen Wettbewerbsmarkt einbezogen. Sie müssen seither unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen arbeiten, die auf Kapazitätsabbau und maximale Kosteneffizienz getrimmt sind. Wirtschaftlich überleben kann in diesem System in der Regel nur ein Krankenhaus, das wächst, das heißt, die Zahl der erbrachten Leistungen im Wettbewerb mit anderen Krankenhäusern permanent steigert.
"Die deutsche Versorgungslandschaft bedarf einer grundlegenden Neuorganisation." Ralf Heyder und Frank Wissing
Ordnungspolitisch ist die undifferenzierte Einbeziehung der Universitätsklinika in diesen Marktbereinigungswettbewerb aus mehreren Gründen kritisch zu hinterfragen:
- Niemandem kann ernsthaft daran gelegen sein, auch nur eine der 33 Universitätsklinika in Deutschland zu schließen. Im Gegenteil: Aktuell führen wir in Deutschland eine Diskussion über eine erhebliche Erhöhung der Studienplatzzahlen in der Medizin. In den letzten Jahren wurden mehrere neue Medizinfakultäten gegründet, bspw. in Augsburg, Oldenburg, Bielefeld oder Neuruppin.
- Die Universitätsklinika sind – um einen Begriff aus der Bankenkrise zu bemühen – systemrelevant. Ein qualitativ gutes Gesundheitssystem kann es ohne eine leistungsstarke Universitätsmedizin nicht geben. Die Universitätsmedizin prägt maßgeblich die Qualität der Ärzteaus- und -weiterbildung, und sie ist wesentlicher Motor für die Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden bzw. deren Weiterentwicklung.
- Die Universitätsmedizin ist ein wichtiger Standortfaktor für Deutschland im internationalen Wettbewerb um Forschung und Entwicklung in der Biomedizin. Wenn Deutschland hier international wettbewerbsfähig bleiben will, muss die deutsche Universitätsmedizin für die besten Köpfe in Medizin und Wissenschaft attraktiv bleiben.
- Die deutsche Versorgungslandschaft bedarf einer grundlegenden Neuorganisation. Es gibt zu viele Krankenhäuser und eine viel zu starre Trennung zwischen ambulanten und stationären Leistungserbringern. Die Zukunft liegt in der Vernetzung zwischen Krankenhäusern unterschiedlicher Versorgungsstufen und mit den Vertragsarztpraxen. Die Universitätsklinika sind dafür prädestiniert, diese Vernetzung zu organisieren und voranzutreiben.
Sonderaufgaben der Universitätsklinika beachten
Aus all diesen Gründen wäre es sehr sinnvoll, die Universitätsmedizin gezielt zu fördern und zu stärken. Stattdessen bewirkt der aktuelle ordnungspolitische Rahmen in der Krankenhausfinanzierung das Gegenteil. Die Universitätsmedizin steht unter enormem Wirtschaftlichkeitsdruck, weil die Krankenhausfinanzierung auf maximale wirtschaftliche Effizienz getrimmt ist und gleichzeitig die besonderen Aufgaben der Universitätsklinika im Fallpauschalen-Einheitspreissystem nicht ausreichend abgebildet sind.
Um nicht missverstanden zu werden: Die Fallpauschalen per se sind für die Universitätsklinika nicht das Problem. Im Gegenteil: Die fallbezogene Finanzierung hat an vielen Stellen auch in den Universitätsklinika für einen Professionalisierungsschub im Management, stringentere Prozesse und mehr Leistungstransparenz geführt. An vielen Stellen wurde die Wirtschaftlichkeit erheblich verbessert.
Das Problem ist die Angleichung der Vergütungen an die Durchschnittskosten nicht-universitärer Krankenhäuser. Hier ist mittlerweile ein kritisches Niveau erreicht. Denn die Universitätsklinika übernehmen zahlreiche Sonderaufgaben, die andere Krankenhäuser nicht in gleichem Umfang leisten. Deshalb entstehen Universitätsklinika höhere Kosten, sie erhalten aber dennoch nur die Einheitspreise.
Folgende Beispiele machen das deutlich:
- In Universitätsklinika muss die Patientenversorgung mit der Forschung in Einklang gebracht werden. Viele Ärzte haben in ihrem Arbeitsalltag beide Hüte auf. Dies stellt höhere Anforderungen an die Organisation als in anderen Krankenhäusern. Davon profitieren Patienten, bspw. in Form einer Behandlung auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Trotz dieses Mehrwerts für die Patienten, beteiligen sich die Krankenkassen nicht an dem Mehraufwand.
- Patienten mit seltenen oder besonders aufwändigen und komplexen Erkrankungen finden oft nur in der Universitätsmedizin adäquate Behandlungsangebote und werden nicht zuletzt deshalb oft von anderen Krankenhäusern oder niedergelassenen Ärzten an die Universitätsklinika verwiesen. Die Fallpauschalen sind aber als Durchschnittspreise kalkuliert, so dass die überdurchschnittlich aufwändigen Patienten nicht auskömmlich finanziert sind.
- Der Umfang, in dem Krankenhäuser an der Notfallversorgung teilnehmen, unterscheidet sich enorm. Universitätsklinika sind hier rund um die Uhr mit einer sehr breit über viele Fachgebiete gefächerten Expertise und umfassender technischer Ausstattung verfügbar, während ein Teil der nicht-universitären Krankenhäuser gar keine Notfallversorgung anbietet. Diese Unterschiede in der Vorhaltung von Behandlungsbereitschaft sind im Vergütungssystem nicht ausreichend differenziert.
- Die Universitätsklinika bilden junge Ärzte zu einem überproportionalen Anteil zu Fachärzten weiter, gerade in den kleineren Fachgebieten. Dieser Mehraufwand wird jedoch nicht refinanziert. Universitätsklinika sind oft die ersten Leistungserbringer, die den Patienten neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden anbieten. In vielen Fällen sind diese Innovationen im Fallpauschalensystem noch nicht abgebildet. Dann gibt es mit den Krankenkassen erbitterte Diskussionen darüber, ob die neue Methode noch Forschung oder schon Patientenversorgung ist. Nur im letzten Fall muss die Krankenkasse bezahlen. Nicht selten bleiben die Universitätsklinika daher bei innovativen Behandlungsangeboten auf den Kosten sitzen.
Reformem stehen zur Diskussion
Diese Problemanalyse ist keine isolierte Einzelmeinung der Universitätsmedizin. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen kommt in seinem jüngsten Gutachten zu ähnlichen Bewertungen.
Er empfiehlt eine Reform des Fallpauschalensystems, um unter anderem die Universitätsklinika auf ein solideres finanzielles Fundament zu stellen: "Eine Differenzierung nach Versorgungsstufen im DRG‐System würde sowohl für versorgungsrelevante Kliniken der Grund-‐ und Regelversorgung ("Landkrankenhäuser") als auch für hochspezialisierte Maximalversorger und Universitätskliniken eine angemessenere Betriebskostenfinanzierung ermöglichen […]."
Zu hoffen ist, dass die politischen Verantwortungsträger diese Empfehlungen aufgreifen und zudem die Länder ihre Investitionsförderung für die Universitätsmedizin wieder deutlich erhöhen. Dann hätte die Universitätsmedizin das wirtschaftliche Fundament, das sie im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe braucht.
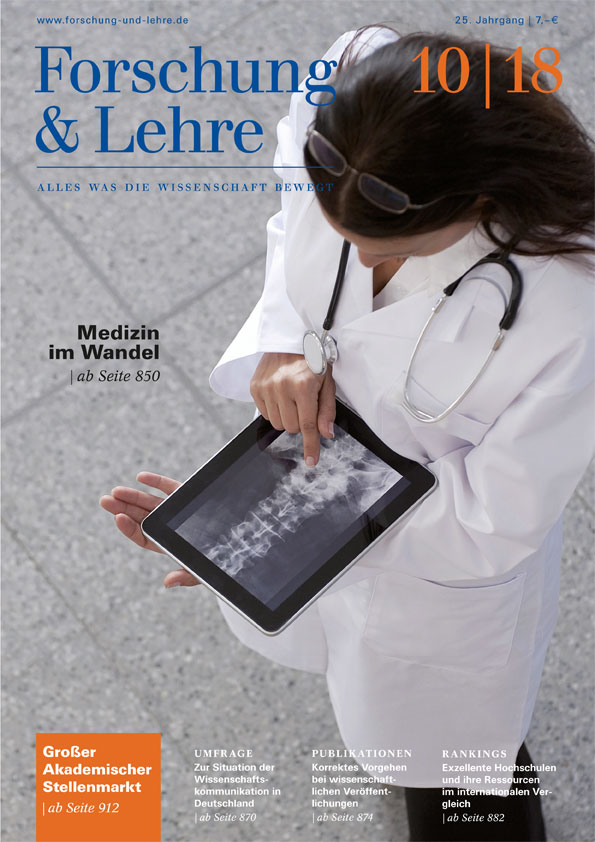


1 Kommentar