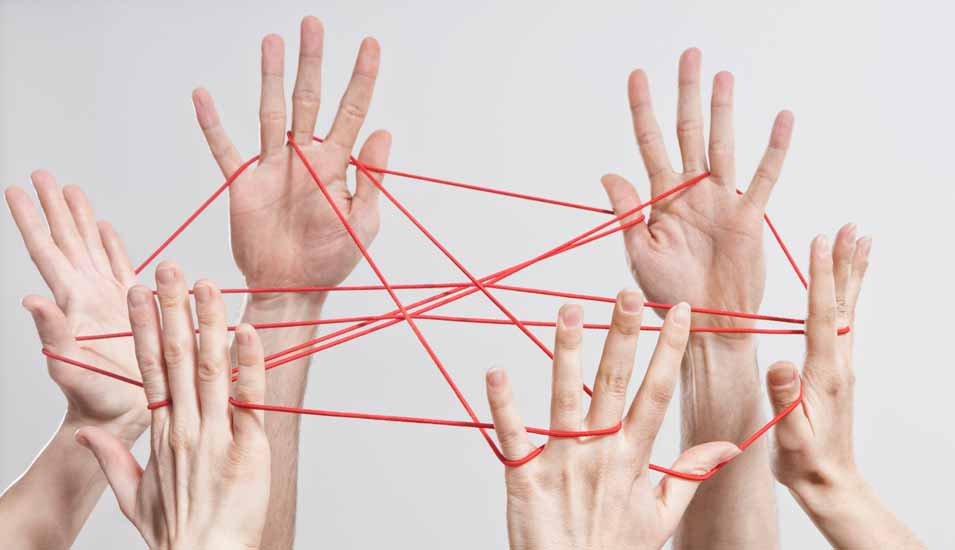Grundrechte in der Pandemie
Die Denormalisierung des Alltags
Die aktuelle Lage erinnert an den Beginn der Pandemie im März 2020, an die Lage zu Weihnachten 2020 und an die Situation zu Ostern 2021. Wir erleben eine kaugummiartig sich hinziehende Denormalisierung des Alltags. Dass die politisch Verantwortlichen nach gut 21 Monaten COVID-19-Pandemie viel gelernt hätten, wäre zu wünschen, ist aber kaum zu glauben. Auf die verfassungsrechtlichen Maßstäbe, die die Pandemieregulierung dirigieren, ist immerhin Verlass. Stimmt das?
Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit
Zum Zauberwort der Pandemie ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip avanciert. Eine staatliche Maßnahme der Pandemieregulierung ist verhältnismäßig, wenn sie geeignet, erforderlich und angemessen (zumutbar) ist. "Geeignet" bedeutet, das gewählte Regelungsinstrument muss die Erreichung des Regelungsziels fördern können. Das Wort "können" ist wichtig, weil es dem Staat einen gewissen Spielraum dabei lässt festzulegen, wie ein von ihm verfolgtes Regelungsziel erreicht werden kann. "Erforderlich" meint, dass es kein gleich wirksames, aber milderes Mittel gibt, kraft dessen sich das Regelungsziel erreichen lässt. Auch insoweit hat der Staat, namentlich der parlamentarische Gesetzgeber oder ein administrativer Normgeber, der eine Rechtsverordnung erlässt, einen Einschätzungsspielraum, der es ihm gestattet, auf der Basis wenigstens vertretbarer Wirkungsannahmen und -zusammenhänge zu agieren.
"'Erforderlich' meint, dass es kein gleich wirksames, aber milderes Mittel gibt, kraft dessen sich das Regelungsziel erreichen lässt."
Das Kriterium "Angemessenheit" soll schließlich verhindern, dass die in Rede stehende staatliche Maßnahme das Grundrecht übermäßig beschränkt. Hierbei kommt es auf eine Güterabwägung an, die das Gewicht des verfolgten Regelungsziels einerseits und die Bedeutung des in Rede stehenden Grundrechts im konkreten Anwendungskontext andererseits in den Blick nimmt. Die Abwägung sollte versuchen, beide Größen in eine "praktische Konkordanz" zu bringen (so das bekannte Wort des früheren Richters des Bundesverfassungsgerichts Professor Konrad Hesse), die beiden möglichst große effektive Geltung verschafft. Dieses Kriterium, für dessen Anwendung – anders als bei der Geeignetheit und der Erforderlichkeit – nach überwiegender Auffassung kein Einschätzungsspielraum besteht, wirkt gleichsam als "letzte Auffanglinie", die regulatorische Maßlosigkeiten, die auf den vorherigen Stufen noch nicht moniert wurden, herausfiltern soll.
Die Rede von verhältnismäßigen Beschränkungen ergibt allerdings nur Sinn, wenn Grundrechte überhaupt beschränkt werden dürfen. Grundrechte sind – von der Menschenwürde abgesehen (Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz) – keine absoluten Größen, sondern ihre Schutzintensität kann minimiert werden, was freilich gerechtfertigt werden muss, vor allem durch Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit. Dahinter steht die Vorstellung, dass Grundrechte die Staatstätigkeit in erster Linie moderieren und disziplinieren, aber nicht stoppen sollen. Zugleich wird anerkannt, dass Regulierung – das konkrete Austarieren gegenläufiger Interessen, das zur Auswahl bestimmter Steuerungsinstrumente führt – keine mathematisch präzise Aufgabe ist, sondern gewisse Toleranzen bei der politischen Gestaltung erfordert.
Es kann also, verfassungsrechtlich betrachtet, mehrere gleich "richtige" Lösungen geben, die politisch unterschiedlich klug erscheinen mögen, aber jedenfalls verfassungsrechtlich vertretbar sind. Dass Dinge aus gutem oder weniger gutem Grund anders gesehen werden können, ist ein Erkennungszeichen der Demokratie. Es relativiert die Bindung des Gesetzgebers an die Grundrechte (Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz), denn diese wirkt gewissermaßen mit einem demokratietheoretisch motivierten Vorbehalt. Anders formuliert: Die "Wirkkraft" der Grundrechte muss "in der Formensprache eines demokratischen Verfassungsstaates zur Geltung kommen" (Kersten/Rixen, Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise, 2021). Demokratie steht also nicht von vornherein als potenziell grundrechtsfeindlich unter Verdacht, sondern ist im Gegenteil ein Weg, Grundrechten effektive Geltung zu verschaffen, ohne dass es dafür immer nur einen richtigen Weg gibt. Diese demokratietheoretisch begründete Relativierung der Grundrechtsbindung, die zum Programm der Verhältnismäßigkeitsprüfung gehört, wird gerade in nicht-juristischen Diskursen über Grundrechte zu wenig wahrgenommen.
Bundesnotbremse, Impfpflicht und Distanzlehre
Wenn aber der Maßstab die Vertretbarkeit ist und nicht eine vorgeblich glasklare Wahrheit, dann ist – gerade in einer volatilen Krise, in der permanent vorläufige Entscheidungen getroffen werden müssen – sehr vieles verfassungsrechtlich zulässig, ohne dass damit schon entschieden wäre, ob eine Maßnahme politisch klug ist. Je multipolarer und komplexer die Abwägungen sind, desto weniger ist das politische Ergebnis verfassungsrechtlich punktgenau vorgegeben. Das gestattet auch weitgehende Maßnahmen wie die "Bundesnotbremse", "3G" (genesen, geimpft, getestet) oder "2G" (genesen, geimpft), soweit sie sich, was immer im Detail zu prüfen ist, am Leitfaden des Verhältnismäßigkeitsprinzips legitimieren lassen.
"Impfverweigerer haben keinen Anspruch darauf, dass ihre zur Willkür mutierte 'Freiheit', andere in Gefahr zu bringen, respektiert wird."
Auch berufsbezogene Impfpflichten können zum Schutze vulnerabler Personen gerechtfertigt sein, wenn die Annahme vertretbar ist, dass andere Maßnahmen nicht taugen, um Menschen, die zum Beispiel in der Pflege oder in Einrichtungen des Gesundheitswesens tätig sind, zur Impfung zu bewegen. Allerdings ist eine Impfpflicht nur so viel wert, wie sie effektiv durchsetzbar ist. Ohne Klarheit über die personalrechtlichen Folgen der Impfverweigerung wird die Impfpflicht ein stumpfes Schwert bleiben. Sie wäre eine unzumutbare Belastung, wenn Impfverweigerern nicht klar vor Augen geführt wird, was die rechtlichen Folgen ihres Verhaltens sind. Impfverweigerer haben zwar keinen Anspruch darauf, dass ihre zur Willkür mutierte "Freiheit", andere in Gefahr zu bringen, respektiert wird. Sie dürfen aber vom Rechtsstaat erwarten, dass er ihre Verantwortungslosigkeit in verlässlich vorhersehbarer Weise sanktioniert.
Und die Hochschulen? Dass sie in der Pandemie derart wenig in den Fokus der politisch Verantwortlichen geraten sind, ist primär kein verfassungsrechtliches Problem. Hier dürfte eher der Stellenwert tertiärer Bildung im politischen Diskurs deutlich werden. Hunderttausende Lehrende und Millionen Studierende haben in einer Mischung aus Fatalismus, Bequemlichkeit und ausgeprägtem Vorsichtsdenken akzeptiert, dass die Lehr-, Lern- und Forschungsfreiheit zur Freiheit geworden ist, Zoom und andere Videokonferenzformate zu nutzen. Die anhaltende Denormalisierung der Lebens- und Denkverhältnisse an den Hochschulen steht exemplarisch für die Frage, ob wir dauerhafte Verschiebungen der Normalitätsvorstellungen erleben, die erst noch reflexiv und emotional eingeholt und als "normal" anerkannt werden müssen. Die Grundrechte des Grundgesetzes schirmen diese Suche nach neuen Antworten gegen Maßlosigkeiten ab. Gebote des guten Lebens, die uns letzte Wahrheiten zur Pandemiepolitik auch an den Hochschulen bescheren, sind sie nicht.