
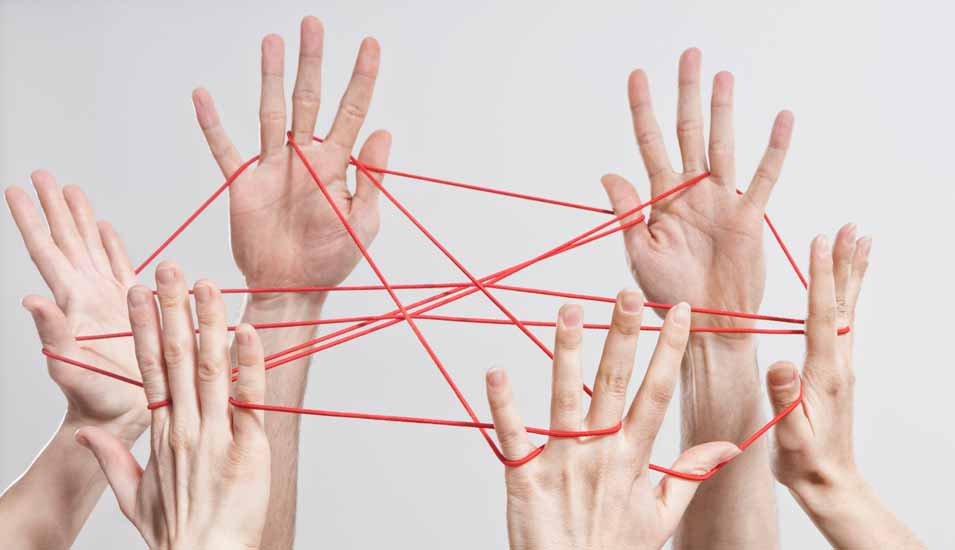
De-Globalisierung
Wie sich die Demokratie durch Corona verändert
Auch wenn der Höhepunkt der Corona-Krise erst bevorsteht und ihre Dauer ungewiss bleibt, ist das Nachdenken über die Krisenbewältigung und die langfristigen Folgen der Pandemie in vollem Gange. Die Fragen betreffen auch das politische System. Alarmistische Prognosen, die die Demokratien im Zerfall sehen, haben seit längerem Konjunktur. Dass die durchaus abwägende Argumentation der Autoren den reißerischen Buchtiteln dabei selten entspricht, ist bemerkenswert. Tatsächlich haben wir es eher mit einem – allerdings grundlegenden – Wandel zu tun als mit einem Niedergang. In diesem Wandel spiegeln sich neue und neuartige Herausforderungen des Regierens, die sich anhand der folgenden vier Stichworte beschreiben lassen: abnehmende Souveränität der nationalstaatlichen Politik im Zuge der Globalisierung, wachsende soziale und wirtschaftliche Ungleichheit, Bedrohung individueller Freiheiten und Zerfall der Öffentlichkeit durch die Digitalisierung und mangelnde Zukunftsverantwortung.
"Tatsächlich haben wir es eher mit einem Wandel zu tun als mit einem Niedergang."
Welche Folgen die Corona-Krise für die Demokratie hat, darüber scheiden sich unter den politischen und wissenschaftlichen Beobachtern schon jetzt die Geister. Während die einen eine Verschärfung der Problemtendenzen befürchten, die die ohnehin brüchige Legitimation der demokratischen Systeme weiter untergrabe, sehen die anderen in der Pandemie eine Chance, Fehlentwicklungen zu korrigieren und die Demokratie – national, europäisch und international – auf eine neue, gesichertere Basis zu stellen. Welches Szenario ist das wahrscheinlichere?
Souveränitätsproblem
Was das Souveränitätsproblem angeht, dreht die Krise die mit der Globalisierung einhergehenden Tendenzen der Entdemokratisierung insofern zurück, als sie den Primat der Politik wiederherstellt beziehungsweise die Wirtschaft diesem Primat nahezu vollständig unterwirft. Der Hinweis, dass an dessen Stelle nun der Primat der Wissenschaft, sprich, der Virologie getreten sei, geht fehl, weil die ohnehin uneinheitlichen Empfehlungen der Wissenschaftler die politischen Verantwortungsträger von der Notwendigkeit nicht entbinden können, verschiedene Ziele gegeneinander abzuwägen. Diese Abwägungen lassen stets Raum für Alternativen. Deshalb gewinnen das Parlament und eine funktionierende Medienöffentlichkeit in der Krise sogar an Bedeutung – trotz der sprichwörtlichen "Stunde der Exekutive", die in Ausnahme- und Notstandssituationen schlägt. Auch über die Grenzen, die der Rechts- und Verfassungsstaat dem Handeln der Regierenden zieht, muss politisch gestritten und wenn nötig von Gerichten entschieden werden.
Die Globalisierung ist einerseits mitursächlich für die Entstehung und rasche globale Ausbreitung des Virus und stellt zugleich ein Hemmnis für die nationale Politik bei der autonomen Gefahrenabwehr und Krisenbewältigung dar. Andererseits versetzt sie uns – durch den wissenschaftlichen und technologischen Austausch – in die Lage, mit solchen Epidemien heute viel besser fertig zu werden als in früheren Epochen der Weltgeschichte. Niemand zweifelt zum Beispiel daran, dass es zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus kommen wird. Dasselbe gilt für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen. Ob sie ähnlich rasch gelingt wie nach der Finanzkrise 2008 wird vor allem davon abhängen, wie stark die von der Pandemie bisher noch weniger betroffenen Entwicklungs- und Schwellenländer in den Abwärtssog mit hinein geraten.
Der Rückzug auf das Nationale war und ist in einer Situation der unmittelbaren Bedrohung ein verständlicher Reflex. Das gilt auch für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, wo dies naturgemäß Unbehagen ausgelöst und tatsächlich zu vielen unschönen Begleiterscheinungen – etwa den unabgestimmt vorgenommenen Grenzschließungen – geführt hat. Dass die EU deshalb geschwächt aus der Krise hervorgehen wird, ist nicht ausgemacht. Dafür muss sie freilich die richtigen Lehren ziehen – indem sie sich für vergleichbare Situationen in Zukunft besser wappnet und indem sie bei der Bewältigung der durch die Krise aufgetürmten Finanzlasten Solidarität mit den wettbewerbsschwächeren Ländern übt. Die hartherzige Haltung, mit der Staaten wie Deutschland und die Niederlande sich der Forderung nach einer zeitlich und sachlich begrenzten Vergemeinschaftung von Schulden ("Corona-Bonds") entgegengestellt haben, wird mittlerweile auch von vielen Ökonomen kritisiert und kann nicht das letzte Wort bleiben.
Soziale und wirtschaftliche Verwerfungen
Die mangelnde Solidarität auf europäischer Ebene dürfte der Sorge entspringen, dass es bereits im nationalen Rahmen schwer genug werden wird, die mit der Corona-Krise verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen halbwegs erträglich abzufedern. Die Pandemie könnte bestehende Ungleichheiten in der Gesellschaft weiter verschärfen und neue entstehen lassen. Was das Schutzgut Leben und Gesundheit angeht, ist das Virus gerade nicht der Gleichmacher, den Ulrich Beck mit seinem bekannten Satz "Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch" als charakteristisches Merkmal der "Risikogesellschaft" beschrieben hat. Hauptbetroffen sind die ohnehin gefährdeten Gruppen – Ältere, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Durch ihre dem eigenen Schutz dienende Isolation haben sie jetzt zugleich in sozialer Hinsicht die größte Last der Pandemie zu tragen. Die seelischen Folgen, die das für die Menschen selbst und ihre Angehörigen hat, sind kaum zu ermessen.
"Was das Schutzgut Leben angeht, ist das Virus gerade nicht der Gleichmacher."
Auch in wirtschaftlicher Hinsicht reißt die Krise tiefe Gräben auf. Die Beschäftigten in der Pflege und im Lebensmittelhandel, die sich als Angehörige der systemrelevanten Berufe jetzt unvermittelt einer neuen Wertschätzung erfreuen, arbeiten häufig in prekären Verhältnissen und zu niedrigen Löhnen. Die meisten von ihnen sind Frauen. Auf der Verliererseite befinden sich zugleich viele Alleinerziehende und Familien mit Kindern, die ihren Nachwuchs zu Hause betreuen müssen. Das ohnehin große Bildungsgefälle wird dadurch weiter vergrößert – mit erheblichen Langzeitfolgen. Ähnlich groß sind die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt. Während die einen über ein sicheres Beschäftigungsverhältnis – etwa im Öffentlichen Dienst – verfügen und von zu Hause aus arbeiten können, müssen die in den ganz oder teilweise stillgelegten Branchen Beschäftigten in Kurzarbeit gehen und vielleicht sogar um ihren Job fürchten. Auch das Privileg des Homeoffice bleibt nur einer Minderheit vergönnt. Der größere Teil der Menschen arbeitet weiterhin im Büro oder Betrieb und setzt sich dort und auf dem Weg dorthin zugleich einem höheren Infektionsrisiko aus.
Digitalisierung
Die Digitalisierung erweist sich für die Bewältigung der Krise in vielerlei Hinsicht als Segen. Man stelle sich vor, eine solche Pandemie hätte die Welt in den 1980er oder 1990er Jahren getroffen – ihre medizinische Bekämpfung hätte sich schwieriger gestaltet, und die sozialen und ökonomischen Folgen eines Lockdowns wären viel gravierender gewesen. Dass ein beträchtlicher Teil der wirtschaftlichen-, Verwaltungs- und Erziehungstätigkeit (im Bildungswesen) vom heimischen Computer aus geleistet werden kann, hilft uns jetzt enorm. Es rächen sich aber auch die Versäumnisse: Gerade im Verwaltungs- und Bildungsbereich wäre noch viel mehr Kompensation möglich, hätte man die digitale Modernisierung ehrgeiziger betrieben. Dass diese Modernisierung mit und nach der Krise umso rascher nachgeholt und es in Gesellschaft, Staat und Wirtschaft kein Zurück mehr in die analoge Welt vor Corona geben wird, zeichnet sich als eine der wichtigsten Langzeitwirkungen der Pandemie schon heute ab.
Blickt man auf die demokratischen und rechtsstaatlichen Aspekte, so hat die Corona-Krise die bekannten Licht- und Schattenseiten der Digitalisierung von neuem offenbart. Einerseits fördert das Netz soziales Engagement und Hilfsbereitschaft, andererseits bleibt es ein notorischer Tummelplatz für Betrüger und die Verbreiter von Falschnachrichten. Auch das Datenschutzthema erhält durch die Möglichkeit, die Ausbreitungswege des Virus mittels Tracking nachzuverfolgen, neue Brisanz. Den Zerfallsprozess der demokratischen Öffentlichkeit hat die Corina-Krise allerdings – zumindest vorübergehend – gestoppt. So wie sich die Bürger in der Notsituation wieder verstärkt den Regierenden zuwenden, gewinnen die traditionellen Medien an Vertrauen zurück.
Bilanz der Demokratien
Dass autoritäre Systeme besser gerüstet seien, eine zukunftsgerichtete Politik zu verfolgen, als Demokratien, ist ein häufig kolportierter Mythos. Dennoch bleibt die Bilanz der Demokratien in Sachen Zukunftsverantwortung schlecht. Am greifbarsten ist dies beim Klimaschutz. In der Wissenschaft herrscht ein nahezu einmütiger Konsens, dass bei einer Temperaturerhöhung von mehr als zwei Grad dramatische Folgen auf die Weltbevölkerung zukommen werden. Gemessen daran sind die heutigen Anstrengungen sowohl auf der Zielebene (der Reduktionsverpflichtungen) als auch bei der Umsetzung deutlich zu gering. Ob sie durch die Corona-Krise einen Schub erhalten werden, ist keineswegs sicher.
Die Vehemenz, mit der der Staat zur Zeit in das Wirtschaftsgeschehen eingreift, um die Pandemie einzudämmen, wird von Befürwortern eines strengeren Klimaschutzes als positives Signal gewertet. Die scheinbar griffige Parallele geht an den Unterschieden zwischen beiden Krisen jedoch vorbei. Zum einen stellt das Corona-Virus eine zwar "unsichtbare", aber doch manifeste Gefahr dar. Beim Klimawandel handelt es sich demgegenüber um eine "schleichende" Katastrophe, deren Folgen – wie drastisch sie auch ausgemalt werden – uns heute noch eher abstrakt vorkommen. Zum anderen sind die Ursachen der Katastrophe und damit auch die Bekämpfungsmöglichkeiten in ihrer Komplexität grundverschieden. Reicht es bei Corona aus, einen Impfstoff zu finden und – bevor das der Fall ist – die Ausbreitung der Seuche durch eine Reduktion der Ansteckungsmöglichkeiten zu bremsen, erfordert die Klimaneutralität eine umfassende Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Die durch sie auf den Plan gerufenen Gegenkräfte sind deshalb ungleich massiver.
"Die Erfahrung der Verwundbarkeit könnte und sollte der Beginn einer Epoche der Nachhaltigkeit sein."
Sollte es eine der Lehren der Krise sein, dass die internationale Gemeinschaft und die Staaten im einzelnen dem Ausbruch vergleichbarer Seuchen in Zukunft besser vorbeugen, wäre das zugleich eine gute Nachricht für die Klimapolitik. Beide Katastrophen sind nämlich gleichermaßen menschengemacht und in ihren Ursachen – wenn man etwa an die Zurückdrängung des Lebensraums von Tieren und Pflanzen denkt – zum Teil identisch. Vor diesem Hintergrund wäre es fahrlässig, die notwendige Ankurbelung der Wirtschaft nach dem Lockdown mit Forderungen nach einer Lockerung der Umwelt- und Klimaschutzziele zu verknüpfen. Die Erfahrung der Verwundbarkeit, die die Pandemie in unser Leben und die gesamte Gesellschaft zurückgeholt hat, könnte und sollte stattdessen der Beginn einer Epoche der Nachhaltigkeit sein. Dass es eine Rückkehr in die Sorglosigkeit des "immer schneller, höher und weiter" der Vor-Corona-Zeit nicht geben wird, erscheint ziemlich gewiss.



0 Kommentare