
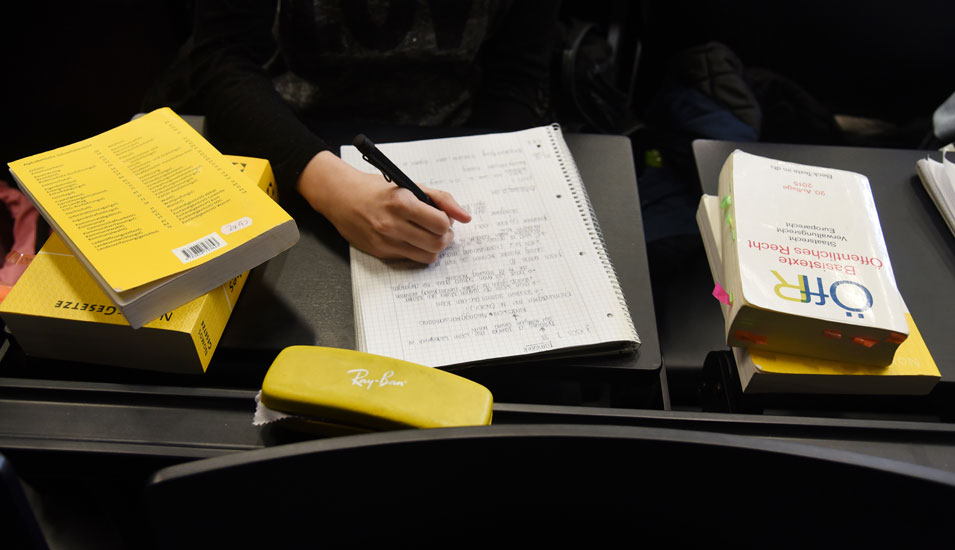
Rechtswissenschaften
Ist die Juristenausbildung in Deutschland zukunftsfähig?
Ein Leitbild für die Juristenausbildung – ist das überhaupt ein Thema? Nein, so könnte bei erster Annäherung die Schlussfolgerung aus der aktuellen Debatte lauten: Ein breiter Meinungsmainstream beurteilt die derzeitige Juristenausbildung und ihren Abschluss in einem überwiegend staatlich organisierten Examen als grundsätzlich gelungen.
Insbesondere das Prüfungsformat der Klausur in Form einer gutachterlichen Lösung von Fällen nach geltendem deutschen Recht ohne Hilfsmittel und in einem sehr engen Zeitfenster wird als bestes Instrument der Beurteilung der Leistungsfähigkeit und des Potenzials eines Kandidaten und einer Kandidatin angesehen. Reformnotwendigkeiten werden daher (wie eigentlich schon immer) lediglich in Randbereichen bejaht.
Aktuell geht es um den Ausgleich von tatsächlichen oder vermeintlichen Defiziten an Chancengleichheit zwischen den Bundesländern. Vor diesem Hintergrund wird die derzeitige Ausdifferenzierung der Schwerpunktbereichsausbildung und -prüfung problematisiert und im Pflichtfachbereich ein wenig am Zuschnitt der einzelnen Unterrichts- und Prüfungsfächer geschraubt. Es geht um technische Details. Im Übrigen steht alles zum Besten, so lautet das Credo. Deutsche Prädikatsjuristinnen und -juristen sind hoch anerkannt, am nationalen und internationalen Arbeitsmarkt gefragt, konkurrenzfähig und für die Zukunft bestens gerüstet.
Nicht unmittelbar klausurrelevant
Gespräche mit Studierenden und Examenskandidaten wecken Zweifel an der Realität der "besten aller Welten". Examensvorbereitung und Examen werden von weiten Teilen der Studierenden als psychisch belastend, intransparent und uninspirierend wahrgenommen. Der Schwerpunkt des Interesses, der Energie und des Zeiteinsatzes liegt auch bei sehr begabten Kandidatinnen und Kandidaten auf Details des geltenden Rechts, sog. Meinungsstreiten bzw. Technizitäten des Gutachtenstils. Das Eingehen auf geschichtliche, politische oder wirtschaftliche Hintergründe einer gesetzlichen Regelung löst im Hörsaal Seufzen oder Langeweile aus.
Dies kann man den Studierenden gar nicht vorwerfen, sie verhalten sich rational apathisch. Ein Prädikatsexamen ist durchaus auch erreichbar, wenn man mit den Namen Kurt Schumacher, Claus-Wilhelm Canaris oder Werner Flume, Gustav Radbruch oder Hans Kelsen nichts verbindet, wenn man im gesamten Studium keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesgerichtshofs im Original und im Ganzen gelesen hat und erst recht keinen Aufsatz oder auch nur eine Anmerkung. Die erfreulichen Klausurnoten haben die Absolventinnen und Absolventen nach eigener Aussage auf der Grundlage von Skriptenstudium und durch den Besuch des privaten Repetitors erzielt. Mehr braucht man offensichtlich nicht. Alles andere ist nicht unmittelbar klausurrelevant, bestenfalls nützlich, vielleicht aber auch Zeitverschwendung. Was nicht geprüft wird, wird in aller Regel auch nicht gelernt. Das ist eine Binsenweisheit, das weiß jeder Dozent - auch ohne didaktische Weiterbildung.
Stört uns dieser Befund wirklich oder sollte er uns stören? Ist die standardisierte und formalisierte Einübung der Lösung von Fällen des geltenden Rechts nicht ein angemessenes Training des Denkapparates, das dazu befähigt, später „alles andere“ „on the job“ zu lernen? Im Folgenden soll die Notwendigkeit für ein Umdenken im Sinne einer Leitbilddiskussion skizziert werden.
Unwissenschaftlich und praxisfern
1. Es gilt als Kernkompetenz des guten deutschen Juristen, konkrete juristische Probleme auf der Grundlage des geltenden Rechts mithilfe des juristischen Handwerkszeugs und der Dogmatik wissenschaftlich überzeugenden und praktischen Lösungen zuzuführen und diese Lösungen in einem geordneten, gutachterlichen Gedankengang zu kommunizieren.
Dabei geht es nicht darum, bekannte Fälle und Lösungsmuster zu reproduzieren. Die zentrale Fähigkeit des guten Juristen wird (zu Recht) gerade darin gesehen, für neue und unbekannte Fälle mit Hilfe der einschlägigen Normen und dem Verständnis der Rechtsordnung überzeugende Lösungsoptionen zu entwickeln. Dies ist auch das Verständnis maßgeblicher Regelwerke für die Juristenausbildung: Die derzeitige Examenspraxis ist nicht nur ganz unwissenschaftlich, sondern auch praxisfern. Sie beruht auf der Fiktion, dass brauchbare Lösungen mithilfe der juristischen Methodenlehre unmittelbar aus dem Gesetz ableitbar sind, sodass man im ersten Examen auf Hilfsmittel wie Kommentare verzichten kann.
Der berufstätige Praktiker wird sich freilich nie allein auf das Gesetz und sein Gedächtnis stützen, sondern seine Überlegungen durch Rückgriff auf die höchstrichterliche Rechtsprechung und Kommentare absichern. Daraus folgt, dass der sachgerechte und professionelle Umgang mit Originalquellen (Urteilen, Kommentaren, Lehrbüchern, Aufsätzen und Anmerkungen, Monographien) in Studium und Examen eine viel größere Rolle spielen muss als bisher. Es wäre schon ein ganz einfacher Schritt in die richtige Richtung, wenn man bereits in der ersten Prüfung Hilfsmittel zulassen würde.
Akzentverlagerung notwendig
2. Darüber hinaus notwendig ist eine deutliche Akzentverlagerung vom Präsenzwissen im derzeit geltenden Recht zu Strukturverständnis und Argumentationsfähigkeit: Die Rechtsordnung verändert sich in allen Bereichen immer schneller, nicht nur als Konsequenz der Aktivitäten des deutschen Gesetzgebers, sondern vor allem auch im Zuge der Europäisierung des Rechts. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass nicht unerhebliche Teile dessen, was man den Studierenden als geltendes Recht vermittelt, in der Zeit ihrer Prüfung, ihrer Referendarzeit und ihrer Berufstätigkeit schon nicht mehr gelten werden.
Vor diesem Hintergrund erscheint Präsenzwissen über das gerade geltende Recht, über das man sich auch in Kommentaren informieren kann, deutlich weniger wichtig und zukunftsfähig als die Kompetenz, Rechtsveränderungen wahrzunehmen, zu verstehen und zu verarbeiten. Dazu ist auch das Verständnis erforderlich, wie und warum neue Regelungen und Regelungskomplexe entstehen, welche Interessen und Kräfte diese Veränderungsprozesse treiben, wie man sie beeinflussen kann und wie der politische und juristische Betrieb funktioniert. Eine „geschichtslose“ Vermittlung und Prüfung des gerade geltenden Rechtes ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern geht auch an der Realität aller juristischen Berufe vorbei.
3. Stärker in Studium und Examen zu berücksichtigen ist schließlich, dass nationale Dogmatik und Methodenlehre im Zuge der Europäisierung des nationalen Rechts ihren Alleinvertretungsanspruch verloren haben und damit auch an Integrationskraft für die Systematisierung des nationalen Rechts. So lassen sich etwa wichtige Probleme in dem Teil des Schuldrechts, der vom europäischen Verbraucherrecht, sowie im allgemeinen Verwaltungsrecht, der vom europäischen Beihilfenrecht bestimmt wird, nicht mehr ohne Weiteres unter Rückgriff auf die altbewährte deutsche Dogmatik realitätsgerecht lösen.
Die Problemlösung muss konform in dem Sinne erfolgen, wie der EuGH die maßgeblichen Richtlinien letztverbindlich auslegt. In Studium und Examen muss daher der Umgang mit Recht in Mehrebenensystemen eine viel stärkere Rolle spielen. Es muss über neue Formate in Studium und Prüfung nachgedacht werden, die diesen Entwicklungen, insbesondere den Herausforderungen von Methodenpluralität und Methodenkonkurrenz, stärker als bisher Rechnung tragen.
Internationalisierung
Aber reicht eine im Wesentlichen am geltenden deutschen Recht mit seinen unvermeidlichen europäischen Bezügen orientierte Ausbildung mit einem etwas stärkeren Akzent auf Strukturverständnis aus, den juristischen Nachwuchs auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten?
Die politische und wirtschaftliche Entwicklung ist weltweit gekennzeichnet von Ungewissheit, Digitalisierung, Disruption und vor allem von Globalisierung. Dies hat unvermeidlich Auswirkungen auf die juristische Praxis. International tätige Unternehmen und Institutionen agieren nicht nur unter den Rahmenbedingungen der Heimatsrechtsordnung, sondern sind mit einer Mehrzahl weiterer Rechtsordnungen mit ganz anderem gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrund konfrontiert. Rechtliche Risiken im Ausland werden zum zentralen Thema. Nicht ohne Grund hat das Internationale Investitionsrecht zur Risikoabsicherung von Auslandsinvestitionen in jüngerer Zeit einen so bemerkenswerten Aufschwung erlebt.
Auf politischer Ebene sind zentrale Themen wie Frieden, Sicherheit und Umwelterhaltung nicht mehr nationalstaatlich zu bewältigen, sondern erfordern ein staatengemeinschaftliches Handeln mit geeigneten juristischen Instrumenten. Daraus folgt geradezu zwangsläufig, dass auch die Juristenausbildung „internationaler“ werden muss. Wir dürfen uns nicht mehr darauf verlassen, dass ein im deutschen Recht solide ausgebildeter Jurist ohne Weiteres in der Lage sein wird, sich in fremde Rechtsordnungen einzuarbeiten.
Wir sollten das Thema Internationalisierung nicht weiterhin an ausländische, insbesondere amerikanischen Law Schools delegieren, die einen teuren LLM für ausländische Juristen anbieten. Derzeit wird im Studium viel kostbare Zeit und Energie mit rechtstechnischen Details und Klausurentraining verschwendet, die in internationale Formate und Inhalte investiert werden könnten: eine Anfängervorlesung im internationalen Recht, internationale Beispiele in allen Fächern, Moot-Court und Verhandlungssimulation als praxisnahe Ergänzung zu traditionellen Vorlesungen.
Unpolitische Rechtstechniker?
Wie sehen wir die Juristen und Juristinnen der Zukunft? Würde es uns ausreichen, wenn sie als weitgehend unpolitische Rechtstechniker in der Lage sind, das positive Recht handwerklich sauber umsetzen, ohne sich als zuständig für die Frage nach der Überzeugungskraft des Inhalts zu sehen? Oder sollen sie bereit und fähig sein, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und die Entwicklung der Rechtsordnung aktiv mitzugestalten?
Das erfordert deutlich mehr als fachliche Brillanz im geltenden Recht, insbesondere Wertesensibilität, Urteilsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Kritikfähigkeit und Mut, die in einem soliden Verständnis der geschichtlichen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wurzeln verankert sind, und außerdem das Bewusstsein, dass die deutsche Rechtsordnung und ihre Dogmatik nur eine unter vielen anderen ist.
Man muss sicherlich mit einfachen Schlussfolgerungen aus der Akte Rosenburg sehr vorsichtig sein, aber eine (eher unscheinbar daher kommende) Information ist frappierend: Fast alle Betroffenen hatten hervorragende Examina, waren also formal als brillante Juristen ausgewiesen. Ein Garant für rechtsstaatliche Haltung (Heiko Maas) war das aber offensichtlich nicht. Ist das heute anders?
Was sagt es über die juristische Ausbildung und das juristische Selbstverständnis aus, wenn der Name Fritz Bauer außerhalb von Veranstaltungen zur neueren Rechtsgeschichte im Studium nicht vorkommt und gleichzeitig bisher kaum jemand Anstoß daran nimmt, dass der wichtigste Kommentar im Privatrecht, den jeder Studierende vom ersten Semester an immer wieder in die Hand nimmt, nach wie vor nach Otto Palandt benannt ist. Über diese Fragen sollte man bei der Diskussion über eine wirkliche Studienreform sprechen!


0 Kommentare