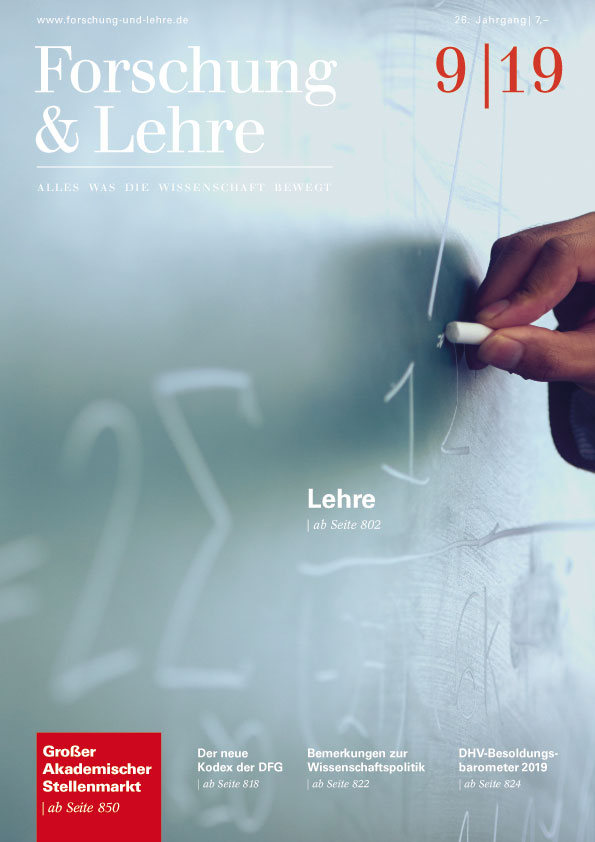Mentoren für Studierende
"Vom Mentoring profitieren immer beide Seiten"
Forschung & Lehre: Wann und wie ist die Idee des Mentorings an der Universität Duisburg-Essen entstanden?
Christian Mayer: Die Idee entstand vor ungefähr zehn Jahren. Da haben wir Professorinnen und Professoren gemeinsam überlegt, wie wir den hohen Abbruchquoten begegnen können. Dabei kam die Idee der Beratung auf. Die Hoffnung war, durch informelle Treffen in Kleingruppen an die abbruchgefährdeten und gescheiterten Studierenden heranzukommen und gemeinsam an den Problemen zu arbeiten. Aber es hat im ersten Ansatz leider nicht so gut funktioniert. In den meisten Fällen bleiben diese Studierenden einfach weg und wir haben dann keine Möglichkeit mehr einzugreifen.
"Wir gehen ganz gezielt auf diejenigen Studierenden zu, von denen wir wissen, dass sie massive Probleme haben."
Vor zwei Jahren haben wir dann das Konzept geändert. Die Betreuung der einzelnen Gruppen übernehmen nun hauptsächlich Studierende. Bei der Beratung durch Professorinnen und Professoren stehen jetzt andere Zielgruppen im Fokus. Wir gehen ganz gezielt auf diejenigen Studierenden zu, von denen wir wissen, dass sie massive Probleme haben – zum Beispiel wenn sie bei Prüfungen mehrfach durchgefallen sind oder die Studienzeiten aus dem Ruder laufen. Wir sprechen sie an und laden sie zu Einzeltreffen ein. Häufig kämpfen Studierende auch mit finanziellen Problemen, müssen nebenher arbeiten und können nur sporadisch einzelne Prüfungsleistungen erbringen. Wieder andere haben aus persönlichen Gründen die Kontrolle über ihr Studium verloren. An diesen Punkten versuchen wir zu helfen. Wir haben also jetzt eine neue Variante entwickelt, bei der wir uns auf die Problem-Studierenden konzentrieren und damit auf die, die sich noch im Universitätssystem befinden.

F&L: Sie sind Mentor im Fachbereich Chemie. Worum geht es in den Gesprächen mit den Studierenden?
Christian Mayer: Unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten Probleme von Studierenden fachlicher Art sind, und jeder Fachbereich hat seine eigenen Problemstellungen. In der Chemie ist es das Praktikum. Man absolviert viele Praktika, die Laborarbeit beinhalten. Früher wurde im Chemie-Unterricht in den Schulen häufiger eine praktische Übung gemacht. Das hat inzwischen deutlich abgenommen. Die Studierenden machen ihre ersten praktischen Erfahrungen also an der Universität, und das führt häufig zu einem Aha-Erlebnis. Sie realisieren dann, dass die Arbeit mit einer gewissen körperlichen Anstrengung verbunden ist und negative Randbedingungen wie Gerüche und gewisse Gefahrenmomente beinhaltet. Diese neuen Erfahrungen schüchtern am Anfang etwas ein und führen manchmal sogar zu einer Aversion gegen die praktische Laborarbeit. Hier muss man als Lehrender aktiv werden und deutlich machen, dass man sich a) daran gewöhnt und dass b) gewisse Dinge typisch sind für die ersten Praktika und sich später etwas entspannen.
Darüber hinaus hat die Chemie ein sehr breites Spektrum von Unterfächern, von der Mathematik bis hin zur biologischen, pharmazeutischen und medizinischen Chemie. Das kann den einzelnen ebenfalls heraus- und überfordern. Viele unterschätzen z.B. den mathematischen Anspruch im Studium. Hier müssen wir Lösungen anbieten, um mögliche Defizite in der mathematischen Vorbildung auszugleichen.
F&L: Wäre es nicht sinnvoll, dass die Schüler im Chemie-Unterricht bereits Erfahrung mit Laborarbeit sammeln? Dann kämen Studierende zumindest in dem Punkt nicht unvorbereitet ins Studium und die Abbrecherquote wäre möglicherweise nicht so hoch.
Christian Mayer: Ich habe viel Verständnis für Chemie-Lehrer, die angesichts der praktischen Probleme (Stichwort Sicherheit) davor zurückschrecken, praktischen Chemie-Unterricht mit Schülern durchzuführen. Das ist in den letzten Jahren immer schwieriger beziehungsweise zu einer heiklen Angelegenheit geworden. Versuche, die früher Standard waren, werden heute als zu problematisch bzw. zu gefährlich eingestuft. Wer will als Lehrer die Verantwortung übernehmen, wenn sich ein Schüler möglicherweise durch einen Versuch bedroht fühlt und zum Beispiel befürchtet, zu viele "chemische Dämpfe" eingeatmet zu haben? Das führt nicht gerade dazu, dass der praktische Anteil im Chemie-Unterricht steigt.
In der Universität werden die Studierenden an die Probleme herangeführt. Das ist auch der Grund, warum das Chemie-Studium so teuer ist. Es braucht sehr viel Betreuungsarbeit, zum Beispiel Assistentinnen und Assistenten, die die möglichen Fehler und Gefahren sehr genau kennen. Sie begleiten die ersten Gehversuche der Studierenden und achten darauf, dass nichts schief geht. Diesen praktischen Teil der Ausbildung zu übernehmen gehört auch zu den Aufgaben einer Universität.
"Das Problem des Mentorings besteht darin, dass die Gespräche bei denjenigen Studierenden am effizientesten sind, die die wenigsten Probleme haben."
F&L: In den Mentoring-Gesprächen können die Studierenden diese und andere Probleme ansprechen. Wie funktioniert das in Ihrem Fachbereich?
Christian Mayer: Im Mentoring-Gespräch arbeiten wir die Probleme gemeinsam heraus, indem ich nachfrage und an den Punkt komme, an dem die negativen Erfahrungen geäußert werden. Auf Anhieb erfahre ich solche Dinge selten. Es braucht zwei bis drei Gesprächsrunden, bevor Studierende diese Aspekte ansprechen. Das generelle Problem des Mentorings besteht darin, dass die Teilnahme und Effizienz der Gespräche bei denjenigen Studierenden am größten ist, die die wenigsten Probleme haben. Die Betroffenen mit den wirklichen Problemen tauchen bei diesen Treffen dummerweise eher nicht auf. Genau an diese Gruppe, die wir eigentlich erreichen wollen, kommen wir damit am schwersten heran.
F&L: Wie würden Sie Aufwand und Ertrag des Mentorings einschätzen?
Christian Mayer: Bei allem, was wir bisher gemacht haben, sowohl beim ersten Teil des Mentorings als auch nach der "Reform" (unter neuen Vorzeichen) hat es sich immer gelohnt. Es ist ja nicht so, dass wir Professorinnen und Professoren kein Interesse daran hätten, dass die Studierenden ihr Studium erfolgreich abschließen. Im Gegenteil. Vom Mentoring profitieren daher immer beide Seiten: die Studierenden werden beraten, der Mentor oder die Mentorin erfährt etwas über die aktuellen Probleme des Studiums.
F&L: Studieren bedeutet auch einen Rollenwechsel vom Schüler zum Studenten. Wird dieser durch Mentoring begünstigt oder eher hinausgezögert?
Christian Mayer: Das ist natürlich ein kritischer Punkt. Durch die Bachelor-Master-Abschlüsse besteht eine generelle Tendenz der Verschulung in den Universitäten. Es könnte sein, dass das Mentoring dies noch verstärkt. Allerdings ist das meines Erachtens nicht unbedingt negativ. Warum soll sich die Universität in diesem Punkt, in der persönlichen Betreuung eines Studierenden, nicht der Schule annähern? Da sehe ich keine Nachteile, solange noch genug Raum bleibt für Persönlichkeitsentwicklung – was einschließt, dass ich den Studierenden ernst und nicht zu sehr an die Hand nehme. Wenn aber der Studierende vor bestimmten Problemen steht, die er möglicherweise eigenständig nicht lösen kann, sollte man helfen. An dieser Stelle könnte die Universität von der Schule lernen.
F&L: In welcher Phase des Studiums ist Ihrer Meinung nach der Betreuungs- und Beratungsbedarf von Studierenden am größten?
Christian Mayer: Der größte Beratungsbedarf und die größte Beratungseffizienz bestehen in den ersten Semestern. Da werden Weichen gestellt und Probleme kreiert, die dann später mit etwas Erfahrung nicht mehr auftreten. In dieser Phase lässt sich das meiste noch bewegen. Daher lautet unser Credo, ganz früh anzufangen. Bei dem zweiten Beratungszweig, den wir anbieten, wenn also Studierende Prüfungen nicht schaffen und wir mit ihnen daran arbeiten, dass sie nicht beim letzten Versuch durchfallen, ist der Beratungsbedarf auch in späteren Semestern vorhanden. Diese Probleme treten aber eher punktuell auf.
"Ein wichtiges Merkmal guter Lehre ist, einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen."
F&L: Als Mentor versuchen Sie, durch intensive und persönliche Gespräche näher an die Studierenden heranzukommen. Wie überwindet man als Lehrende bzw. Lehrender in der Vorlesung die Distanz und erreicht, dass die fachliche Botschaft bei den Studierenden ankommt?
Christian Mayer: Es kommt darauf an, persönlichen Eindruck zu hinterlassen. Das ist grundsätzlich ein wichtiges Merkmal guter Lehre. Das setzt meines Erachtens nicht unbedingt eine Vorbildfunktion voraus. Auch der sehr lässige, etwas abgehobene oder gar exzentrische Charakter kann die Studierenden so beeindrucken, dass das, was er vorträgt, hängen bleibt.
F&L: Funktioniert eine Vorlesung auch über Youtube?
Christian Mayer: Da bin ich ziemlich altmodisch. Für mich ist der persönliche Eindruck sehr wichtig. Videos oder andere Formen der digitalen Lehre ersetzen nicht das persönliche Erleben einer Vorlesung. Wenn man das ausklammert, verliert man ein wesentliches Element von dem, was Lehre ausmacht. Es gibt zwar großartige Youtube-Videos von Lehrenden, die auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich glaube, es ist sehr viel schwieriger, so etwas richtig und ansprechend hinzubekommen. Man muss schon einen sehr guten Draht haben zu dem, was man lehrt, um auf einem Video den gleichen Eindruck zu hinterlassen wie im echten Leben. Grundsätzlich funktioniert es nicht ohne einen klaren Wissens- und Verständnisvorsprung.
Auf Seiten der Studierenden höre ich immer wieder, es sei unglaublich anstrengend, Vorlesungen auf Videos anzuschauen. Die vielfältigen Ablenkungen zu Hause machen es nicht leicht, man muss bewusst die Konzentration auf etwas richten, und es besteht die Gefahr, dass man aus dieser Konzentration herausgenommen wird. Wenn man in einer Vorlesung sitzt, ist das anders, dann passiert es eben um einen herum. Es erfordert wesentlich mehr Willensanstrengung, bewusst diese Konzentration beizubehalten, wenn das Umfeld eines Hörsaals fehlt.