

Freundschaft
Können Wissenschaftler befreundet sein?
Forschung & Lehre: Herr Dr. Schobin, was bringt Menschen dazu Freundschaften einzugehen?
Janosch Schobin: Die Frage kann auf unterschiedliche Weise beantwortet werden. Ein zentraler Ansatz ist aber, Freundschaft als einen Ausdruck menschlicher Grundbedürfnisse anzusehen. Freundschaften gibt es in praktisch allen uns bekannten menschlichen Kulturen, allerdings mit großen Unterschieden, in der Art und Weise, wie sie sich äußern. Aber gerade, weil sie kulturuniversell sind, liegt die Vermutung nahe, dass sie auf elementaren menschlichen Bedürfnissen beruhen, wie etwa dem Wunsch gemocht, sozial anerkannt und gebraucht zu werden, oder dem Bedürfnis nach Vertrautheit und emotionaler Geborgenheit. Dass Freundschaften das leisten, findet die ethnographische Forschung sogar in Kontexten, in denen Freundschaften als soziale Institution starke ökonomische Verpflichtungen beinhalten. Zu denken ist hier etwa an sogenannte Bondfriendships in ostafrikanischen Kulturen, in denen Freunde einander Zugang zu Gütern und Gegenständen bieten müssen, die ihnen anderweitig verwehrt oder schwer zugänglich wären. Selbst in diesen Fällen zeigen aktuelle Studien, dass affektive Unterstützung und soziale Anerkennung eine zentrale Rolle spielen. Psychologische Studien zeigen wiederum, dass Menschen, bei denen das Persönlichkeitsmerkmal der Verträglichkeit stärker ausgeprägt ist, eher stabilere Freundschaften haben. Es wird vermutet, dass das daran liegt, weil es leichter ist, sich ihnen anzuvertrauen und bei ihnen sicher zu fühlen.
F&L: Sie sagten, es gibt mehrere Gründe für Freundschaften. Welche noch?
Janosch Schobin: Die Beobachtung, dass Freundschaften aus affektiven Bedürfnissen heraus gesucht werden, lässt sich auch umdrehen. Die These besagt dann, dass nahezu alle Kulturen Freundschaftstypen kennen, die eine starke instrumentelle oder hedonistische Dimension haben. Das ist auch in westlichen Kulturen so: „Friends with Benefits“ sind auch bei uns ein großes Thema ─ und das nicht erst seit ein paar Jahren. Schon Aristoteles unterschied bekanntlich zwischen der Tugendfreundschaft auf der einen Seite und den Lust- und Nutzenfreundschaften auf der anderen Seite.

F&L: Welche Bedeutung haben Freundschaften heute, im Gegensatz zu früheren Zeiten?
Janosch Schobin: Wenn mit früher ca. das 18. und 19. Jahrhundert gemeint ist, gibt es drei zentrale, ineinander verschränkte Prozesse, die zu einer tiefgreifenden Veränderung der Freundschaft in westlichen Gesellschaften beigetragen haben. Erstens veränderte sich im Zuge der Industrialisierung der Ort der Freundschaftswahl. Freunde wurden mehr und mehr unter nicht verwandten Personen gewählt. Das wirkt aus unserer heutigen Sicht erstmal seltsam, aber selbst das deutsche Wort Freundschaft war lange ein Wort, das eine bestimmte Form von Verwandten beschrieb. Man kann das etwa in Gustav Freytags historischem Romanzyklus „Die Ahnen“ ablesen. Dort sind mit der Freundschaft die Verwandten der Hausherrin gemeint, die mit ihr im Haus leben. Das war ein Wortgebrauch, der im 19. Jahrhundert noch so verstanden wurde, aber zunehmend altertümlich wirkte.
Die zweite große Veränderung im Übergang zur Moderne ist, dass sich die soziale Form der Freundschaft änderte; eher kollektive Formen der Freundschaft wurden durch solche verdrängt, die individuelle Erfahrung und Gefühle betonen und die folglich stärker als Beziehungen zwischen Einzelnen zu deuten sind. Ich habe es mit den "Bondfrienships" schon angedeutet: Freundschaften sind in vielen Kulturen nicht primär als Beziehungen zwischen einzelnen Individuen zu deuten, sondern sie stellen Beziehungen zwischen Familien, Klans, Abstammungsgruppen und Kulturen her. Erst im Rahmen der Individualisierungsprozesse des 18. und 19. Jahrhunderts wurde Freundschaft nach und nach eine Beziehung, die wir primär als eine Beziehung zwischen besonderen Einzelnen betrachten. Montaignes berühmtes "Weil er er und ich ich war" war zu seinen Lebzeiten eine ziemlich außergewöhnliche Sicht auf Freundschaft, wie Vergleiche mit der höfischen Literatur seiner Zeit gut zeigen. Aber sie hat sich bei uns als eine Art Norm durchgesetzt.
"Freundschaft ist eine Art universelle Lückeninstitution."
Der dritte wichtige Prozess ist, dass sich mit dem Ort der Freundschaftswahl und dem Normaltyp der Freundschaft auch die sozialen Unterstützungsfunktionen von Freunden veränderten. Freunde sorgten immer weniger direkt für die materielle Absicherung und die Gewährleistung der physischen Sicherheit. Ihre Aufgaben verschoben sich dafür zunehmend in den Bereich der Bereitstellung von Orientierungshilfen (Rat) und psychischer Unterstützung. Das lässt sich auf unterschiedliche Modernisierungsprozesse zurückführen wie etwa auf die Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Systeme oder auf die zunehmende Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols. Eine soziologische Daumenregel besagt, dass Freundschaft eine Art universelle Lückeninstitution ist: Sie sichert jeweils die zentralen menschlichen Bedürfnisse ab, die andere soziale Institutionen wie der Staat, der Klan oder die Familie nicht abdecken können oder wollen.
30. Juli – Tag der Freundschaft
Die Vereinten Nationen erinnern jedes Jahr am 30. Juli an die Bedeutung der Freundschaft zwischen Menschen, Völkern, Ländern und Kulturen. Der Internationale Tag der Freundschaft wurde offiziell 2011 eingeführt, geht aber auf Initiativen aus verschiedenen Ländern zurück.
F&L: Können Freunde sogar Familienersatz sein?
Janosch Schobin: Im Prinzip ja. Bei uns gibt es mittlerweile ein bedeutsames Bevölkerungssegment, das freundschaftszentriert lebt. Darunter verstehe ich, dass Freundinnen und Freunde einen Großteil aller wesentlichen sozialen Bedürfnisse abdecken. Wie groß diese Gruppe eingeschätzt wird, hängt natürlich etwas davon ab, wie man das erfasst, und wie man die sozialen Bedürfnisse definiert. Aber in jedem Fall handelt es sich um eine Gruppe, die wenn sie eine Partei gründen würde, über die Fünf-Prozent-Hürde käme. Auch kann man aktuell eine Bewegung in der Politik erkennen, die diese Realität mehr und mehr anerkennt. Das ist aus meiner Sicht auch nötig. Ich habe zum Beispiel über Pflege in Freundschaften geforscht und über die Frage, ob sie im Kohortenvergleich zunimmt. Wird sich die Generation der Babyboomer häufiger von Freundinnen und Freunden pflegen lassen als die Kriegsgeneration? Aktuell ist die leibesbezogene Pflege durch Freundinnen und Freunde ein eher seltenes Phänomen, das eher nicht zunimmt.
F&L: Warum pflegen Freunde einander nicht?
Janosch Schobin: Es gibt da eine ganze Reihe von Hürden. Manches davon sind "weiche" Faktoren. Das fängt bei der typischen Art von Beziehung zu Freunden an. Freundschaft ist bei uns ideell eher auf wechselseitige Unterstützung ausgelegt. Bei langfristiger leibesbezogener Pflege handelt sich aber eher um eine Art von Hilfe, die man nicht mehr erwidern wird. Andere Hürden sind eher von der "harten" Art: Freunde leben selten zusammen, müssten aber bei den aktuellen Pflegegeldsätzen für Angehörige zumeist ihren eigenen Haushalt aufgeben, um sich die Pflege von Freundinnen oder Freunden leisten zu können. Auch Geschlechterfragen spielen eine Rolle. Frauen nennen etwa viel häufiger eine Freundin oder einen Freund als Person, die sie im Pflegefall um Hilfe bitten würden und könnten. Die "Ressource" Freundschaft ist aus unterschiedlichen Gründen sozial sehr ungleich verteilt. Die vielen Hürden bedeuten aber nicht, dass Freundschaft im Pflegebereich irrelevant ist. Studien zeigen, dass das Arbeitsvolumen, das Freundinnen und Freunde in der häuslichen Pflege erbringen, in etwa dem von ambulanten Pflegediensten entspricht. Das ist also bereits heute ein substanzieller Faktor im Pflegesystem. In den nächsten Dekaden wird alles noch viel enger. Die Generationen, die im Kohortenvergleich wirklich wenig Kinder haben, kommen so langsam erst in das Alter, in dem sich der Pflegebedarf häuft. Wir sind als Gesellschaft also gut beraten, uns zu fragen, wie wir freundschaftszentrierte Pflege besser unterstützen können.
"Was für Freunde wir haben, bestimmt bis zu einem gewissen Grad, ob wir die Universität überhaupt erreichen."
F&L: Welchen Einfluss üben Freundschaften auf Berufswahl und wissenschaftliche Karrieren aus?
Janosch Schobin: Das ist meines Wissens weniger gut erforscht. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass Freunde in den USA dazu tendieren, ähnliche Wahlfächer in der High-School zu wählen. Ganz allgemein kann gesagt werden, dass Freundinnen und Freunde einander in sehr vielen Vorlieben und Verhaltensweisen beeinflussen. Freunde nähern sich beispielsweise über die Zeit etwa im Musikgeschmack oder den politischen Einstellungen an. Ich halte die These deswegen nicht für abwegig, dass sie zumindest einen kleinen Einfluss auf unsere Berufswahl haben. In schulischen Kontexten ist auch ganz gut erforscht, dass Freundinnen und Freunde den Schulerfolg vorhersagen, etwa weil schulvermeidendes Verhalten und Alkoholkonsum unter Freunden "ansteckend" sind. Was für Freundschaften wir haben, bestimmt also bis zu einem gewissen Grad, ob wir die Universität überhaupt erreichen, was eine wissenschaftliche Karriere zumeist überhaupt erst möglich macht. Ob man ein begonnenes Studium abschließt, abbricht oder das Fach wechselt, hängt wiederum auch bis zu einem gewissen Grad von Freundschaften ab, die man im Rahmen des Studiums schließt. Über das spätere Karrierestadium gibt es jedoch vor allem Studien über Zitationsnetzwerke, deren Metriken heute geradezu zur Definition von wissenschaftlichem Erfolg geworden sind. Was für menschliche Beziehungen sich dahinter verbergen, ist aber, soweit ich sehe, weitestgehend ungeklärt.
F&L: Inwiefern sind Freundschaften auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtig?
Janosch Schobin: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind auch Menschen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die prinzipiellen Vorteile von Freundschaften nicht auch für sie gelten sollten. Darüber hinaus gibt es vor allem biografische Forschung zu den Freundschaften von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Diese Forschung unterstreicht, wie wichtig wissenschaftlich ähnlich gesinnte Freundinnen und Freunde für die Entwicklung der eigenen Ideen sind, aber auch wie wichtig sie manchmal sind, um einen intellektuellen Ort in der Wissenschaft zu finden. Zum einen ist da der Typus der Mentoren-Freundschaft, die beides zugleich ist: Eine enge, affektive Bindung und eine orientierende Beziehung von Menschen, die sich intellektuell auf Augenhöhe begegnen. Ich denke hier etwa an die innige Freundschaft, die Rózsa Peter mit der wesentlich jüngeren Vera Sós verband. Vera Sós hat mit Paul Erdős und Alfréd Rényi später ein kleines mathematisches Theorem bewiesen, dass das Freundschaftstheorem genannt wird: Wenn jedes beliebige Paar aus einer Gruppe von Menschen genau eine gemeinsame Freundin oder einen gemeinsamen Freund hat, dann muss es eine Person geben, die mit allen Menschen der Gruppe befreundet ist. Das ist nahezu eine Metapher für die Position von Paul Erdős in einem Freundeskreis, der mathematisch wahnsinnig produktiv war.
"Die Mentoren-Freundschaft ist beides zugleich: Eine affektive und eine orientierende Beziehung."
Eine andere Freundschaftskategorie, die aus meiner Sicht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtig ist, sind agonistische Freundschaften – also Freundinnen und Freunde, die das eigene Denken in Frage stellen und herausfordern, mit denen eine intellektueller Wettstreit besteht, der aber stets das Denken des oder der Anderen ernst nimmt. Dabei handelt es sich um ein Freundschaftsmodell, über das aktuell aber eher in der Philosophie als in den Sozialwissenschaften geforscht wird, etwa indem Nietzsches Freundschaftsvorstellung mit denen des Aristoteles kontrastiert werden. Daran zeigt sich vielleicht auch das Beste an der Freundschaftsforschung: Sie hat sich in den letzten 2.500 Jahren noch nie für disziplinäre Grenzen interessiert.

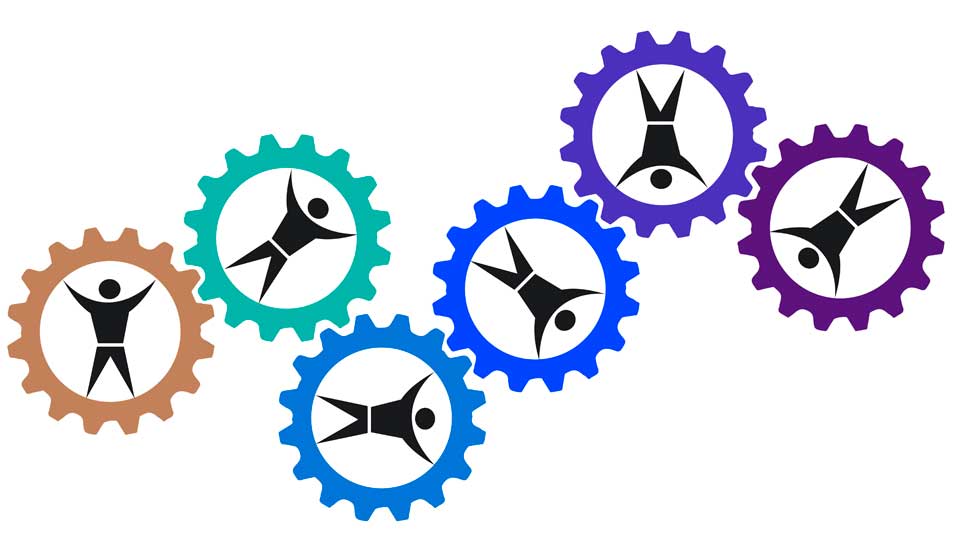
0 Kommentare