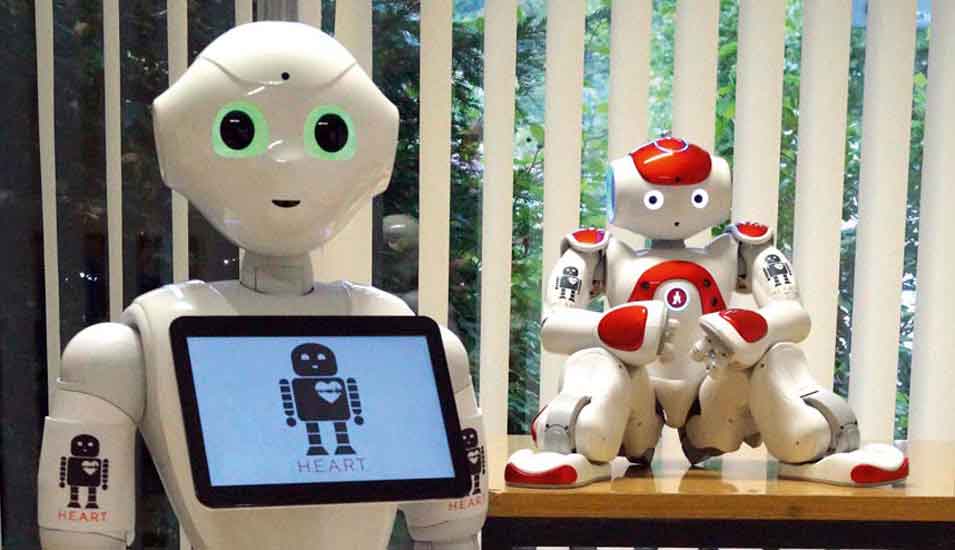Digitalisierung in der Medizin
Mitten im größten Wandel
Forschung & Lehre: Künstliche Intelligenz ist in der Medizin auf dem Vormarsch. Das Uniklinikum in Essen soll ein "Smart Hospital" werden. Was verstehen Sie darunter?
Jochen A. Werner: Unter "Smart Hospital" verstehen wir ein intelligent arbeitendes, Sektoren überschreitendes Klinikum, das nicht durch Beton, sondern durch die umfassende Krankengeschichte seiner Patienten begrenzt wird. Dieses digitalisierte und prozessoptimierte Krankenhaus fokussiert nachdrücklich auf den Menschen, also auf Patienten, deren Angehörige und ganz besonders auf seine Mitarbeiterschaft. Während sich die Medizin mitten im größten Wandel aller Zeiten befindet, arbeiten Kliniken vielfach immer noch in tradierten Strukturen. Dies kann kein Zukunftsmodell sein, wenn wir die enormen Fortschritte der medizinischen Entwicklung den Menschen zugänglich machen wollen. Mit der Digitalisierung wird es möglich, die Mitarbeiter im Krankenhaus von patientenfernen Aufgaben zu entlasten, um ihnen mehr Zeit und Zuwendung für die uns anvertrauten Menschen einzuräumen. Dieses Smart-Hospital-Konzept erfordert extreme Veränderungen im Denken und Handeln aller in den Klinikbetrieb involvierten Personen. Dazu gehört das Aufbrechen vorhandener Kommunikations- und Hierarchiestrukturen. Führungsqualität wird noch bedeutsamer. Smart Hospitals brauchen Leader und keine Bosse. Wir müssen Berufe neu denken und über Personalplanungen nicht nur sprechen, sondern sie tatsächlich in die Zukunft richten.
F&L: In welchen Bereichen wird die Künstliche Intelligenz (KI) jetzt schon eingesetzt? Können Sie ein paar Beispiele nennen?
Jochen A. Werner: Die konkretesten medizinischen Beispiele für erfolgreich eingesetzte KI stammen aus der Radiologie, was nicht verwunderlich ist, handelt es sich bei diesem Gebiet doch um die am längsten digitalisierte Fachdisziplin. So hat das Essener Team um Professor Forsting Applikationen entwickelt, mit denen man viel tiefer in die Biologie eines Tumors hineinschauen kann, als es bislang möglich war. Beispielsweise hilft ihnen die KI bei Abschätzungen zur Wahrscheinlichkeit von Fernmetastasen, zur Diagnostik bestimmter Lungenerkrankungen oder zur Bestimmung des Knochenalters. KI-Anwendungen in weiteren Fachdisziplinen wie beispielsweise Pathologie, Kardiologie, Notfallmedizin oder Augenheilkunde sind mancherorts bereits implementiert. Letztlich werden wir mit Hilfe komplexer Algorithmen für unsere Patienten maßgeschneiderte Strategien für Vorsorge, Früherkennung und Behandlung nicht nur in der Onkologie anbieten.

F&L: Wo sehen Sie zukünftig die größten Potenziale?
Jochen A. Werner: Neben neuen Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie wird auch die Pflege von der Digitalisierung profitieren, indem diese Berufsgruppe durch intelligente Systeme von zeitraubenden Dokumentations- und Bürokratieaufgaben entlastet wird. Hierbei hilft die Elektronische Patientenakte. Digitalisierung erleichtert zudem Transparenz und unterstützt Patientensicherheit vielfältig. Sie hilft weiterhin, die tiefen Gräben zwischen Klinik und Niederlassung zu überbrücken, was schon deshalb von höchster Bedeutung ist, weil die Rückversicherung zur Versorgungsqualität immer mehr in den Mittelpunkt unseres Handelns gelangt. Kürzlich wurde beim Deutschen Ärztetag das Fernbehandlungsverbot gelockert. Auch hieraus ergeben sich große Potenziale. Schließlich gehen Telemedizin und virtuelle Medizin ineinander über.
F&L: Was wird aus dem Arztberuf? Widerspricht die KI-basierte Medizin nicht dem ärztlichen Selbstverständnis?
Jochen A. Werner: Das Gegenteil ist richtig. Das ärztliche Ethos ist davon geprägt, dem Menschen immer die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. Das war zu allen Zeiten so. Die Ärzte werden auch künftig verantwortungsvoll die wachsenden Möglichkeiten der Digitalisierung für ihre Patienten nutzen. Dies zeichnet sich deutlich ab. Entscheidend ist die bereits verbreitete Selbsterkenntnis der Ärzteschaft, schon heute nicht mehr Träger des gesamten medizinischen Wissens der eigenen Fachdisziplin zu sein. Vielmehr wird beim Arzt von morgen die Nutzung digitaler Informationen eine wesentlich größere Rolle spielen. Hierzu gehört auch der begleitende Einsatz von KI bei diagnostischen Vorgängen. Beispielhaft genannt ist das System von Ada Health an der Grenze zwischen Arzt und Patient. Genombasierte Entscheidungen werden von Ärzten und Datenspezialisten gemeinsam getroffen. Dies und noch viel mehr sind anstehende Entwicklungen. Festzuhalten bleibt aber auch, dass keine Maschine und kein Algorithmus die umfassende Rolle des Arztes einnehmen wird. Er ist und bleibt die Instanz, die auch künftig die relevanten medizinischen Grundsatzentscheidungen trifft – mit seiner ärztlichen Expertise, aber auch als Manager und Interpretierer externer Daten und digitaler Informationen.
F&L: Sind Klinikärzte bereit, den Vorhersagen eines Algorithmus zu vertrauen?
Jochen A. Werner: Klinikärzte werden auch künftig dem Algorithmus nicht blind vertrauen, sondern sich letztlich die Entscheidungen über die grundlegende Strategie bei der Behandlung ihrer Patienten nicht aus der Hand nehmen lassen. Und das ist auch gut so. Eine solche Vertrauensbasis muss überhaupt erst einmal wachsen. Bei aller Begeisterung für den Einsatz von KI sollten wir stets vor Augen haben, dass es auch und ganz besonders in der Medizin extrem wichtig ist, Qualitätsstandards zu definieren. Kein maschinelles Verfahren funktioniert ohne Kontrolle, keines erlaubt blindes Vertrauen. Werden die Algorithmen auf Basis schlechter Daten trainiert, resultieren daraus schlechte Algorithmen. Qualitätsgerichtete Trainingsdatensätze könnten hier mehr Sicherheit geben. Und es ist noch viel komplexer, wenn man KI nicht nur in der Diagnostik, sondern auch für die Therapie einsetzen will. Hier könnte für die Bewertung therapierelevanter Empfehlungen bedeutsam sein, ob die Daten aus einem konservativen, einem interventionellen oder einem chirurgischen Fach kommen. Es müssen also noch ganz viele Fragen geklärt werden, bis ein breites Vertrauen bei Ärzten in die Anwendung von KI erzielt wird.
F&L: Was kommt in einem "Smart Hospital" auf die Patienten zu? Wie wird sich die Arzt-Patienten-Beziehung verändern?
Jochen A. Werner: Viele Ärzte verbringen die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit administrativen Aufgaben. Mit der anstehenden maschinellen Entlastung in diesem Bereich bleibt mehr Zeit für die Patienten. Die daraus resultierende intensivierte Arzt-Patienten-Beziehung ist schon deshalb erforderlich, weil wir es ja bereits heute immer mehr mit aufgeklärten, selbstbewussten Patienten zu tun haben, die ärztliche Entscheidungen hinterfragen. Zudem wird die Arzt-Patienten-Beziehung künftig weniger hierarchisch geprägt sein als vielmehr von Kommunikation und Partnerschaft. Die Ärzte werden im engen Austausch mit ihren Patienten Entscheidungen unter Nutzung aller digitaler Möglichkeiten treffen, mit einem anderen Rollenverständnis, aber nach wie vor als Entscheidungsträger. Gleichermaßen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Digitalisierung nicht zu einem automatisierten, entmenschlichten Krankenhaus führen wird. Um den Entwicklungsprozess zum Smart Hospital möglichst patientenzentriert zu gestalten, haben wir unser "Institut für PatientenErleben" gegründet. Nochmals, intelligente Computersysteme sollen und werden dabei helfen, die Patienten besser zu versorgen. Sie ersetzen keine Zuwendung.
F&L: Bleibt in einer zum "Smart Hospital" umgebauten Universitätsklinik mehr Zeit für die Wissenschaft?
Jochen A. Werner: Natürlich bleibt mehr Zeit für Patienten und für Wissenschaft. Es kann doch nicht angehen, dass wir aufwendige Clinician Scientist Programme etablieren, den Nachwuchs zur Teilnahme motivieren und dann nicht alles daran setzen, die maximal mögliche Zeit wissenschaftlich oder klinisch zu verwenden. Wir wollen den Anteil von Büroarbeit minimieren.
F&L: Wie muss sich die Medizinerausbildung verändern, um die Studierenden auf die KI-unterstützte Medizin vorzubereiten?
Jochen A. Werner: Natürlich wird sich die Medizinerausbildung verändern, und dies ist zunächst nicht ein Frage der KI. Wir benötigen ein neues Kompetenzprofil der angehenden Ärzte. Dies betrifft zum einen das Arbeiten in einer zunehmend digitalisierten Umgebung. Zum anderen müssen wir kommunikative Qualitäten, gepaart mit Befähigungen zum empathischen Handeln intensivieren. Auch in diesem Kontext reicht ein Verharren in Traditionen schon lange nicht mehr. Die Digital Natives suchen nach ihnen entgegenkommenden Konzepten zur Medizinerausbildung. Dass dieses Realität wird, zeigt der im vergangenen Sommer gestartete erste digitale Medizin-Studiengang nach EU-Recht. Das EU Studienmodell EDU (European Digital University) für Humanmedizin bietet einen dreijährigen Bachelor und einen zweijährigen Master of Medicine-Studiengang an. Erster klinischer Partner für den Erwerb des "Bachelor of Medicine" ist die Helios Kliniken GmbH. Diese Entwicklung ist ein weiteres Beispiel fürs digitale Zeitalter. Auf der einen Seite gibt es die Medizinstudiengänge an traditionellen deutschen Universitäten. Dazu ergänzend entstanden und entstehen Medizinstudiengänge in Kooperationsmodellen wie z.B. Kassel-Southhampton, deren Sinnhaftigkeit von manchem immer noch hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand hinterfragt wird, und jetzt starten digital basierte Medizinerausbildungen, letztendlich länderübergreifend. Vielleicht wäre es klug, über den nächsten Ausbildungsschritt unter dem Aspekt des Gemeinsamen zu diskutieren.