

Evolutionsbiologie
Die Liebe kennt ganz verschiedene Formen
Romantische Liebe, Zweierbeziehungen und häufiger Sex gehören zur Natur des Menschen. Gemeinsam dienen sie einer unverzichtbaren biologischen Funktion: eine verlässliche und dauerhafte Betreuung der Kinder sicherzustellen. Ohne die damit verbundenen Mühen und Anstrengungen gäbe es weder Verliebtheit, noch feste Bindungen noch die besondere Lust beim Sex. Und seit wann gibt es die enge Verknüpfung von Lust, Liebe und Fürsorge? – Seit es Menschen gibt!
Dies zumindest behauptet das sogenannte Standardmodell der menschlichen Evolution. Schon unsere frühen Vorfahren, die vor etwa zwei Millionen Jahren lebten, hätten Gefühle wie Verliebtheit, Verbundenheit und Eifersucht gekannt. Spätestens zu dieser Zeit hätten die Männer einzelne Frauen begleitet und die Frauen ihrerseits waren ihrem Partner sexuell treu, auch wenn sie andere Optionen hatten. Die Paarbindungen wiederum gelten als eine unentbehrliche Voraussetzung für väterliche Fürsorge. Damit waren zum einen die materiellen Bedingungen für die Evolution des Gehirns gegeben: eine ausreichende und hochwertige Nahrung.
Zum anderen erhielt der kulturelle Fortschritt eine völlig neue Dynamik: Denn jetzt konnten nicht mehr nur die Mütter und Großmütter, sondern auch die Väter und Großväter ihre Erfahrungen und ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben. Wenn dieses Argument richtig ist, dann haben die romantische Liebe, die Eifersucht beider Geschlechter sowie das fortdauernde sexuelle Begehren die evolutionäre Entwicklung von unseren noch äffischen Vorfahren zu echten Menschen erst möglich gemacht.
Traditionen werden als naturgegeben wahrgenommen
Alles in allem erinnert das Standardmodell an traditionelle Vorstellungen von Ehe und Familie. Es wird zwar nicht die lebenslange Einehe gefordert, sondern lediglich, dass die Paare zusammenbleiben, solange die gemeinsamen Kinder intensive und andauernde Zuwendung benötigen. Dementsprechend würde man von einigen Jahren ausgehen. Nichtsdestoweniger werden Traditionen, mit denen man aufwächst, wie Verliebtheit, Heirat und Familie, leicht für selbstverständlich und naturgegeben gehalten, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind.
Könnte es also sein, dass es sich beim Standardmodell weniger um Wissenschaft als um eine Projektion weltanschaulicher Vorurteile und moralischer Normen handelt?
Im Folgenden möchte ich kurz drei alternative Modelle für das menschliche Liebesleben vorstellen und diskutieren, wie sich aus biologischer Sicht entscheiden lässt, welches Modell am ehesten zutrifft. Eine erste Interpretation geht davon aus, dass Menschen in Bezug auf ihr Liebes- und Sexualleben ein "unbeschriebenes Blatt" sind, das heißt, dass ihr Verhalten von kulturellen Traditionen, Moden oder spontanen individuellen Wünschen bestimmt wird.
Sollte dies zutreffen, würde die Biologie keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Ein zweites Modell beruht sowohl auf biologischen als auch auf ethnologischen Beobachtungen und besagt, dass Menschen zur Vielehe neigen (Polygamie, "Harem"). Das dritte Modell schließlich postuliert, dass Menschen von Natur aus Gruppenstrukturen mit variablen Sexualbeziehungen und ohne exklusive Liebesbindungen bevorzugen ("Kommune"). Wie das Standardmodell gehen die beiden letzten Modelle davon aus, dass das menschliche Liebesleben von unserer Biologie mitbestimmt wird, sie kommen aber zu anderen Ergebnissen.
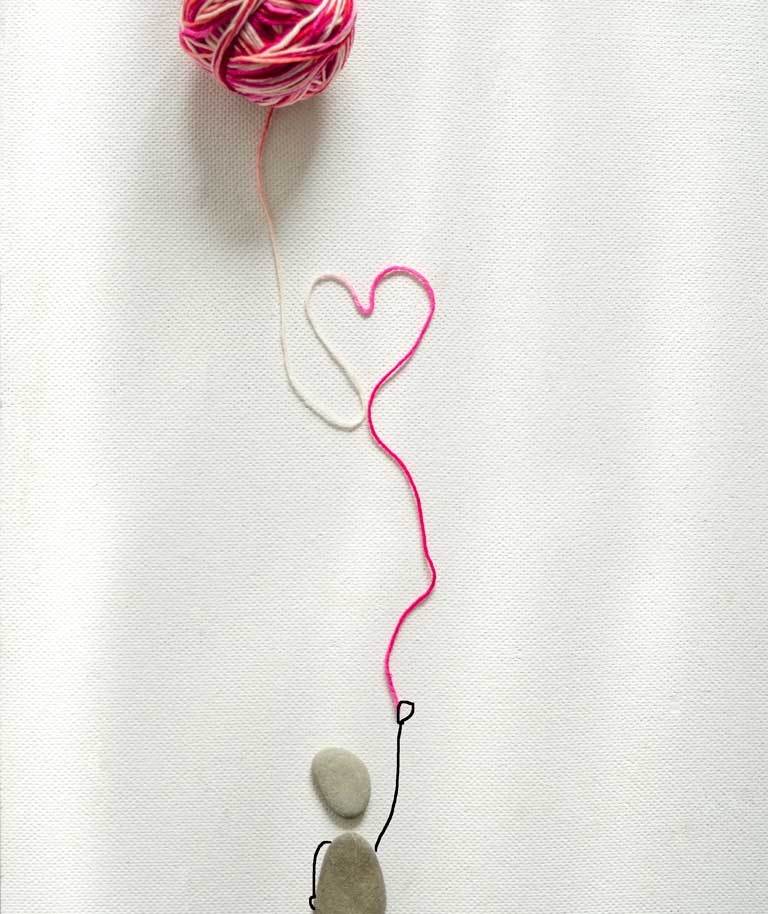
Lässt sich der Streit über die Natur der Liebe lösen?
Die Suche nach den biologischen Ursachen menschlicher Verhaltensweisen steht ganz allgemein vor dem Problem, dass Menschen immer auch kulturell, das heißt durch Vorbild und Erziehung, geprägt sind. Dies gilt auch für unser Liebes- und Sexualverhalten, denn keine soziale Gemeinschaft verzichtet hier auf Einflussnahme. In vielen Kulturen wird die Partnerwahl streng kontrolliert.
Manche sexuellen Neigungen werden von frühester Jugend an gefördert, andere unterdrückt. Wie also kann man in Anbetracht der immer präsenten, kulturellen Faktoren eventuell vorhandene, genetisch angelegte Vorlieben für bestimmte Formen des Zusammenlebens identifizieren?
Eine Lösung für dieses Problem kannten bereits die vergleichenden Anatomen des 18. Jahrhunderts: Sie hatten beobachtet, dass es enge Verbindungen zwischen dem Verhalten eines Tieres und seinen körperlichen Merkmalen gibt. Die Lebensweise eines Raubtieres beispielsweise stellt andere anatomische und physiologische Anforderungen als die eines Pflanzenfressers. Analoges gilt für Sexualität und Liebesleben.
Auch diese lassen sich als komplizierte Werkzeuge verstehen, bei denen verschiedene Teile aufeinander abgestimmt sind und die nicht willkürlich verändert werden können, ohne das Funktionieren des Ganzen zu stören.
Wenn es richtig ist, dass man von anatomischen und physiologischen Merkmalen direkt auf Verhaltensdispositionen schließen kann, dann lässt sich das Problem der kulturellen Überformung menschlicher Verhaltensweisen elegant umgehen. Notwendige Voraussetzung wäre lediglich, dass es körperliche Merkmale gibt, die eng mit bestimmten Verhaltensdispositionen gekoppelt sind. Das ist der Fall.
Die Kommune
Besonders aussagekräftig und vergleichsweise einfach zu messen ist in diesem Zusammenhang das Gewicht der Hoden im Verhältnis zum Körpergewicht. In gemischten Gruppen haben die Männchen deutlich größere Hoden als bei Paarbindung oder in Harems. Bonobos beispielsweise haben relativ zum Körpergewicht fast zwanzigmal schwerere Hoden als Gorillas. Warum ist das so?
Wenn es nur um die Befruchtung geht, genügen kleine Hoden wie bei den Gorillas. Wenn die Weibchen aber wie bei den Bonobos kurz nacheinander mit mehreren Männchen kopulieren, dann entscheiden Menge und Zusammensetzung des Spermas mit über den Sieg im Kampf um die Vaterschaft. Dann ist der Penis zudem oft mit Kratzern, Schaufeln oder Geißeln versehen, um das Sperma des Vorgängers zu entfernen.
Und bei Menschen? Ihre Hoden wiegen circa 40 Gramm bei 70 Kilogramm Körpergewicht. Damit haben Männer zwar größere Hoden als ein Gorilla-Männchen (30 Gramm bei 170 Kilogramm), aber sehr viel kleinere als Bonobos (135 Gramm bei 40 Kilogramm).
Schon aus dieser anatomischen Tatsache allein lässt sich ziemlich sicher schließen, dass Männer nicht für eine Lebensform gemacht sind, in der die Frauen regelmäßig kurz nacheinander Sex mit verschiedenen Partnern haben.
Beim "Kommune"-Modell, demzufolge die sexuelle Eifersucht ein kulturelles Artefakt ist, und das das menschliche Liebesleben im Wesentlichen auf Gruppensex, Partnertausch und zwanglose Affären reduziert, handelt es sich dementsprechend um eine kaum realisierbare Utopie.
Bei existenzieller Bedrohung oder zur Feier außergewöhnlicher Erfolge gab und gibt es in Vergangenheit und Gegenwart immer wieder kollektive sexuelle Ausschweifungen. Dass sich die "freie Liebe" aber als alltagstaugliches System etablieren lässt, ist aus biologischen Gründen unwahrscheinlich.
Der Harem
Anders sieht es bei der Frage aus, ob Menschen monogam oder doch eher polygam veranlagt sind. In den westlichen Industrienationen gilt die Einehe als das Übliche und einzig Normale. Dies ist indes keineswegs selbstverständlich: Nur fünfzehn Prozent aller heutigen Kulturen fordern diese Art von Beziehung! Im Vergleich dazu wird in 85 Prozent der Kulturen irgendeine Form der Vielehe praktiziert. Nimmt man nur diese Zahlen als Anhaltspunkt, dann könnte man vermuten, dass die Menschen von Natur aus polygam sind.
Was lässt sich aus Sicht der Biologie dazu sagen? Gibt es körperliche Merkmale, aufgrund derer man zwischen Mono- und Polygamie unterscheiden kann? Die Antwort ist ja. Und zwar gibt es bei Säugetieren eine statistische Beziehung zwischen dem Unterschied im Körpergewicht von Männchen und Weibchen und der Abweichung vom Paarungssystem der Monogamie. Als allgemeine Faustregel gilt: Je größer der durchschnittliche beziehungsweise maximale Harem in einer Art ist, umso größer ist auch der körperliche Unterschied.
Was lässt sich daraus für das sexuelle Verhalten der Männer schließen? Sie sind im Durchschnitt 15 Prozent schwerer als Frauen, d.h. Menschen sind etwas weniger dimorph als zum Beispiel Schimpansen. Damit gehören sie zu den mild polygynen Arten. Für diese Schlussfolgerung sprechen noch eine ganze Reihe weiterer biologischer Merkmale, die bei Säugetieren mit Haremsbildung und Polygynie gekoppelt sind. Männchen werden unter diesen Bedingungen eher auf Erfolg in aggressiven Auseinandersetzungen als auf Langlebigkeit selektiert. Als Folge ist die Mortalität männlicher Embryonen höher, weshalb mehr Jungen als Mädchen gezeugt und geboren werden.
Männliche Jugendliche kommen später in die Pubertät und sterben häufiger. Und schließlich altern Männer schneller und leben kürzer als Frauen. Insofern scheint es sich beim heute vorherrschenden Paarungssystem der Menschen, das sich durch Monogamie und milde Formen der Polygynie auszeichnet, um ein altes evolutionäres Erbe zu handeln.
Wenn es in der Evolution der Menschen Vielehen gab, dann waren diese aber nicht sehr ausgeprägt und keine dauerhafte Norm. Dafür sprechen auch Beobachtungen an heutigen Jägern und Sammlern. Mehrfachehen kommen zwar vor, sind aber eher selten. Das hat zur Folge, dass die sexuelle Konkurrenz zwischen den Männern abgeschwächt ist – eine wichtige Voraussetzung für gemeinsames Jagen und andere Formen der Zusammenarbeit.
Warum also trägt die Monogamie zum sozialen Frieden bei? Weil sie die Konkurrenz der Männer um die Frauen zeitlich begrenzt und schwächeren Gruppenmitgliedern einen gewissen Schutz gewährt. Das gilt auch umgekehrt für die sexuelle Konkurrenz der Frauen.
Paare und Gruppen
Allgemein lassen sich Menschen als eine sich häufig paarende Art charakterisieren, mit vergleichsweise reduzierter sexueller Konkurrenz und starker Paarbindung. Dieses Paarungssystem – Monogamie innerhalb einer sozialen Gruppe – ist eher selten und kommt nur bei wenigen Primatenarten vor.
Durch diese spezielle Situation hat das menschliche Liebesleben einige charakteristische Eigenschaften angenommen, die in dieser Kombination sehr ungewöhnlich sind: Die romantische Liebe, den versteckten Eisprung der Frauen, den häufigen und privaten Sex sowie die visuelle Unauffälligkeit der Genitalien, um nur einige Beispiele zu nennen.
Die romantische Liebe und das intensive Sexualleben der Menschen lassen sich in diesem Zusammenhang als evolutionäre Lösungen eines emotionalen und sozialen Problems verstehen: Wie lassen sich Zweierbeziehungen in größeren Gemeinschaften absichern, wenn es nicht möglich ist, den Partner oder die Partnerin ständig zu bewachen, da die Geschlechter bei der Nahrungssuche getrennte Wege gehen?
Wie plausibel erklären die evolutionsbiologischen Szenarien und Korrelationen Sexualität und Liebesleben heutiger Menschen? Es ist unbestritten, dass menschliches Verhalten auch auf diesem Gebiet sehr variabel ist und von erlernten Reaktionen überlagert wird. Diese Vielfalt lässt sich verstehen, wenn man sie als lebendigen Kompromiss zwischen dem Wünschenswerten und dem Möglichen sieht.
Die Wünsche selbst – nach Lust, Anerkennung, Zärtlichkeit und Kindern – sind biologisch vorgegeben. Aber die Strategien der Liebe müssen variabel und anpassungsfähig sein, da die Lebenssituation jedes Einzelnen und in jeder Gesellschaft anders ist. Dabei ist viel möglich, aber nicht alles: Werden die biologischen Grenzen zu häufig und zu lange überschritten, kommt es zu körperlichen Störungen und seelischen Problemen.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Menschen – zumindest zeitweise – zu den traditionellen Mustern von Verliebtheit und Zweierbeziehung zurückkehren, auch wenn sie die Möglichkeit hätten, die unterschiedlichsten sexuellen Verhaltensweisen und Partnerschaftsformen zu leben.
Literaturhinweis
Zum Thema ist vom Autor das Buch "Die verborgene Natur der Liebe: Sex und Leidenschaft und wie wir die Richtigen finden" im C.H. Beck Verlag erschienen (2016).


