

Hochschullehre
Wie Gruppenarbeit im Studium besser gelingt
Bei Gruppenarbeiten wirken drei Dinge zusammen: eine Gruppe, eine Aufgabe und eine Interaktionsstruktur. Gruppen sind keine Ansammlung von Menschen, aber auch kein Team. Diese beiden Abgrenzungen sind wichtig, denn im Gegensatz zur Ansammlung bilden sie bezüglich der Aufgabe eine Einheit, die in die Interaktion tritt. Im Gegensatz zum Team jedoch sind sie keine Einheit in einer Organisation, die auf ein Ziel ausgerichtet und mit den nötigen Ressourcen ausgestattet ist. Gruppen sind loser gebunden, gemeinsame Arbeitstraditionen sind nicht zwangsläufig etabliert und die Zielorientierung ist nicht das, was die Gruppe verbindet.
Die Gruppe tritt zusammen und erhält eine Aufgabe. Diese zu bearbeiten ist das Ziel. Das Ziel ist also nicht das Ergebnis, sondern die Erfüllung der Aufgabe. Diese Differenz ist bedeutsam, da die Motivation in den Unterscheidungen nach Deci/Ryan hier über die externe Regulation (Kontrolle, Belohnung oder Strafe) oder über Introjektion (Notwendigkeit, weil andere Handlungsziele sonst beeinträchtigt sind) erfolgt. In beiden Fällen bleibt die Identifikation mit dem Ziel aus. Natürlich können Gruppenarbeiten in Wirklichkeit für Teams konzipiert sein oder ein Teamverhalten erfordern. Das ist zum Beispiel in Projektphasen in kleinen Studiengängen der Fall.
Rahmenfaktoren für erfolgreiche Gruppenarbeit
Ob Studierende die Gruppenarbeit so interpretieren, hängt von verschiedenen Rahmenfaktoren ab:
- arbeitsfunktionale Gruppenzusammensetzung,
- gemeinsames Gedächtnis von Erfolg oder Misserfolg bisheriger Arbeiten,
- komplexe Aufgaben, die unterschiedliche Fähigkeiten benötigen oder zumindest eine parallele Bearbeitung von quantitativ anspruchsvollen Aufgaben.
Umgekehrt gilt: Je zufälliger die Zusammensetzung, je geringer eine gemeinsame Arbeitstradition und je qualitativ beziehungsweise quantitativ beanspruchender eine Aufgabe ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe bestenfalls eine Gruppe ist, bei der die Mitglieder bekannt sind und alle überhaupt in das von der Aufgabe vorgesehene Interaktionsgefüge einsteigen.
Befragt man Studierende, wie sie Gruppenarbeiten wahrnehmen, dann stößt man vor allem auf vier Probleme, die mit den bisherigen Überlegungen zusammenhängen:
- ungleich verteilte Arbeitsbelastung,
- unproduktive und unkoordinierte Austauschrunden,
- Arbeitsergebnisse bleiben unter den Möglichkeiten ungleiche individuelle Lernleistung, was aber im Gruppenprodukt nicht sichtbar ist.
Diese Wahrnehmungen passen nicht recht zu den Verheißungen der Gruppenarbeit, seit sie in den 1980er Jahren gerade in Seminaren die Hochschulen erreichte. Sie sollte den Austausch der Studierenden fördern und damit einen individuellen Kompetenzerwerb im sozialen Prozess heterogener Gruppen unterstützen. Die Aufgaben sollten so gewählt sein, dass die Studierenden eigenständig fachlich fit werden und mit hoher Motivation Lernprodukte erzeugen, die in der normalen Lehre nicht erreichbar sind. Die Gruppe sollte selbst dafür sorgen, dass die individuelle Belastung passt und damit die Selbststeuerung unterstützt wird. Eine starke Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die dazu führt, dass Gruppenarbeit bei vielen Studierenden eher gefürchtet ist und passiv hingenommen wird.
"Gruppenarbeit ist bei vielen Studierenden eher gefürchtet und wird passiv hingenommen."
Fehler im Umgang mit Gruppenarbeiten
Analysiert man die normale Gruppenarbeit, dann fallen zwei Gruppen von didaktischen Fehlern im Umgang mit Gruppenarbeiten auf:
Erstens die ungeprüfte Annahme, dass Studierende
- durch Gruppenarbeiten motiviert werden, weil sie die Möglichkeit erhalten, sich selbst zu steuern,
- sich im vorgegebenen Interaktionsgefüge ausreichend verbal und nonverbal synchronisieren können, um eine Gruppenidentität zur Erfüllung der Aufgabe zu bilden,
- ko-konstruktive Kooperationsprozesse in den Rollen in Machtsituationen (Ressourcen, Deutungshoheit, Entscheidungsalgorithmen) ausführen können.
Zweitens die wenig didaktisch reflektierte Konzeptionierung von Gruppenarbeiten
- als bloße Methodenvarianz, ohne sie als harten Arbeitsprozess zwischen Lernvoraussetzungen und Zielen mit Blick auf Prüfungen zu denken. Wenn die Prüfung eine individuelle Leistung bleibt, ist die Arbeitsform nur bedingt sinnvoll oder sie muss als Instrument für einen verdichteten Lernprozess transparent gemacht werden.
- oft mit unterkomplexen, reproduktiven Aufgaben, die Kollaboration nicht funktional brauchen. Hier wird Nähe zwischen Menschen eingefordert, die letztlich unpersönliche Performanz verstärkt.
- nur bis zur Aufgabenerstellung. Mit den Ergebnissen wird nicht komplex weitergearbeitet, die Vernetzung, Verdichtung und vor allem die Sicherstellung der individuellen Kompetenzentwicklung nach Gruppenarbeiten bleibt aus.
- ohne die eigene Rolle im Interaktionsgefüge zu definieren. Studentische Selbstorganisation ist anspruchsvoll und braucht eine komplexe Begleitung durch Lehrende im Spagat zwischen Unterstützung, Kontrolle und Laufenlassen.
Anspruchsvolle Konzeption
Gruppenarbeit ist sinnvoll – zum Beispiel konzipiert in einem didaktischen Rahmen wie der CORE-Dynamik (Reis u.a. 2018) –, aber sehr anspruchsvoll. Sie erfordert von allen viele Ressourcen und ist nichts für zwischendurch. Es sei denn, die Studierenden sollen einfach nur für sich sein. Dann sollten aber auch die Ergebnisse offenbleiben. Macht man sich die oben beschriebenen Herausforderungen klar, wird man von ihr vielleicht öfter auch Abstand nehmen und sie nicht so inflationär unbedacht einsetzen, weil jede schlechte Praxis auch ihre Folgen für die Motivation, die soziale Synchronisation und das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Teamarbeit hat, die später im Berufsleben benötigt werden.
Digitale Lehre in den "Corona-Semestern" hat alle Effekte verstärkt: Komplexe digital gesteuerte Projektarbeiten haben genauso gut funktioniert und den studentischen Alltag bereichert. Schlechte Gruppenarbeiten führten zu leeren Breakout-Räumen mit alleingelassenen Reststudierenden und zu additiven Ergebnispräsentationen, die in Moodle-Systemen abgelegt, aber nicht weiter genutzt wurden. Zielfreie Breakout-Sessions ohne Lehrende waren willkommene Austauschrunden, um der eigenen Isolation zu entgehen. In der gegenwärtigen Lehrsituation nach Corona sind Gruppenarbeiten eine Chance, wenig ausgebildete soziale Synchronisation zu üben (aufmerksames Dasein, zuhören, verstehen, offene Fragen benennen, Gemeinsames bestätigen und festhalten). Hier werden die Wirkungen der "Corona-Semester" am stärksten sichtbar. Aber das Fehlen der Voraussetzungen macht die Anforderungen an Lehrende noch größer, die intervenieren und die Prozesse selbst als Lerngegenstand thematisieren müssten. Ohne diese Arbeit sollte man nicht hoffen, mit der Gruppenarbeit herzustellen, was sie voraussetzt.
Zum Weiterlesen
Reis, Oliver; Corves, Annette; Hoyer, Isabelle; Nyquist, Elin (2018): Reziprozität zwischen Lehrenden und Studierenden als Kern der Kompetenzorientierung – eine Grundsatzklärung. In: Neues Handbuch Hochschullehre A 1.14, S. 1-18.

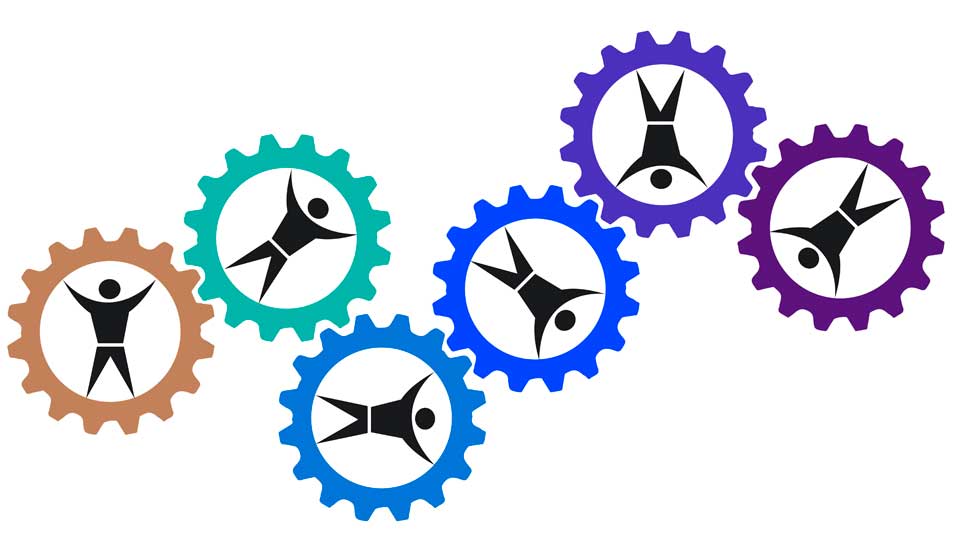

0 Kommentare