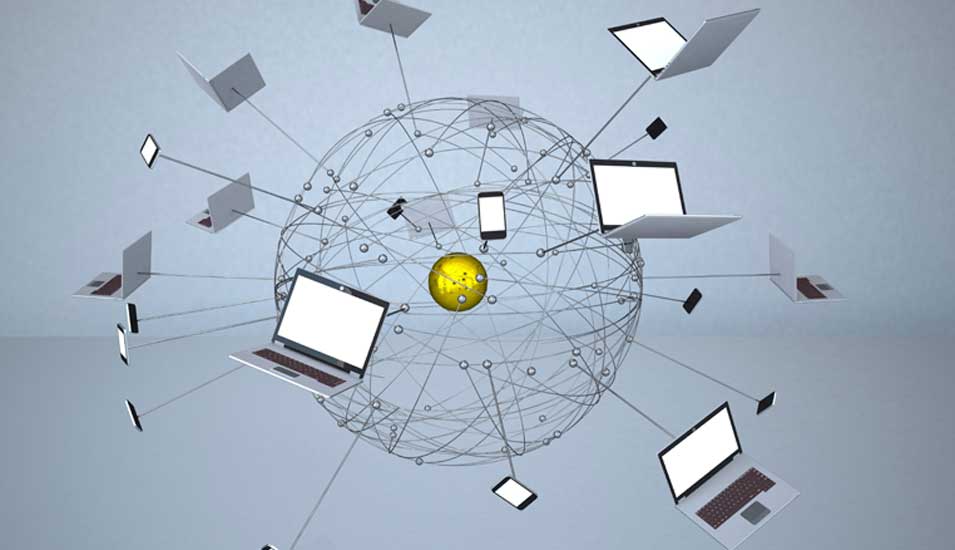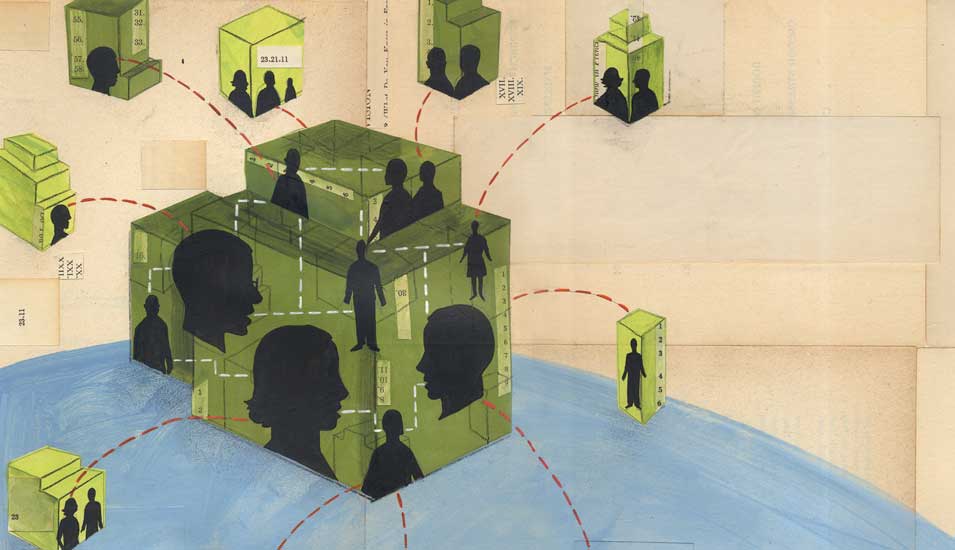

Publizieren
"Open Access sollte freiwillig sein"
Ich halte die Möglichkeit eines kostenlosen Zugangs zu Publikationen für eine Bereicherung der wissenschaftlichen Veröffentlichungskultur, solange sie auf Freiwilligkeit beruht. Gern nutze ich Open Access zuweilen auch selbst. Doch sehe ich es kritisch, dass zentrale Argumente in der Open-Access-Debatte als alternativlos dargestellt werden, obwohl sie es bei genauer Analyse nicht sind. Ein Zwang zu Open Access wird von vielen Wissenschaftlern als Einschränkung ihrer Entscheidungsfreiheit empfunden. Er erzeugt überdies Bürokratie und kostet die Autoren Geld. Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen sowie aktueller Diskussionen zu "Plan S" ist es meines Erachtens angebracht, die kritischen Aspekte von Open Access einmal näher zu beleuchten.
1. Die These vom geldgierigen Verlag
Das Bild vom bösen Wissenschaftsverlag zieht sich wie ein roter Faden durch öffentliche Stellungnahmen zu Open Access. Kritiker führen ins Feld, dass das Geschäft von einigen wenigen Großverlagen wie Springer-Nature, Elsevier und Wiley dominiert werde und diese auf Grund ihrer vermeintlichen Marktmacht hohe Gewinne erwirtschaften würden. Die Handlungen der Verlage werden oft mit moralisierenden Begriffen wie "hemmungslos" und "in Geiselhaft nehmen" beschrieben.
Ich halte dieses Bild aus einem kapitalismuskritischen Blickwinkel für nachvollziehbar. Jedoch bildet es das vielfältige Meinungsspektrum publizierender Forscherinnen und Forscher nicht annähernd vollständig ab. Aus einer freiheitlichen Perspektive stellt sich die Sache nämlich ganz anders dar.
Das Streben von Unternehmen nach hohen Gewinnen ist in einer Marktwirtschaft ebenso wenig verwerflich wie das Streben von Privatpersonen nach hohem Einkommen. Im Gegenteil, es bildet die Grundlage unseres Wohlstands, sofern es sich im Rahmen geltender Gesetze bewegt. Ebenso wie Bleibeverhandlungen, Leistungszulagen und Nebentätigkeiten legale Mittel professoraler Einkommensmaximierung sind, hat ein Verlag das Recht, hohe Gewinne zu erwirtschaften. Davon profitieren keineswegs nur Milliardäre, sondern auch zahlreiche Kleinanleger aus der Mitte der Gesellschaft sowie Pensionsfonds, die Renten für unsere alternde Gesellschaft verwalten.
Übrigens finde ich es widersprüchlich, wenn Kolleginnen und Kollegen eine 30-prozentige Verlagsrendite als unmoralisch bezeichnen und gleichzeitig iPhones mit Gewinnspannen von über 100 Prozent benutzen.
Das Gewinnstreben von Wissenschaftsverlagen hat meines Erachtens sogar gute Seiten: Es legt die Schwächen unseres öffentlich finanzierten Wissenschaftssystems schonungslos offen. Verlage erwirtschaften nämlich dort hohe Renditen, wo sie auf schwach organisierte Forschergemeinden und auf universitäre Bibliothekskommissionen stoßen, die sich trotz stundenlanger Diskussionen nicht auf Prioritäten beim Zeitschriftenkauf einigen können.
"Eine starke Selbstorganisation ist das beste Mittel gegen hohe Gewinne von Wissenschaftsverlagen."
Umgekehrt ist eine starke Selbstorganisation das beste Mittel gegen hohe Gewinne von Wissenschaftsverlagen. In einigen Gebieten wie etwa der Physik gelingt dies sehr gut. Die Amerikanische Physikalische Gesellschaft (APS) veröffentlicht in eigener Regie Physical Review Letters (PRL), Physical Review A, B, C, D, E, Review of Modern Physics und eine Reihe weiterer Journale, die in der Fachwelt ein exzellentes Ansehen genießen. Als Konkurrenz zum Flaggschiff PRL bietet Springer-Nature das Produkt Nature Physics an.
Eine kleine Preisrecherche zeigt jedoch, dass sich APS in diesem Segment auf Grund seiner hohen Reputation eine selbstbewusste Preispolitik leisten kann und es Springer-Nature in diesem Segment schwer fallen dürfte, hohe Renditen zu erzielen. Ich habe von meinem privaten Rechner aus den Preis für die pdf-Version eines Einzelartikels jeweils bei PRL und bei Nature Physics erkundet. Dabei bietet mir die gemeinnützige Organisation APS den Einzelartikel bei PRL zum Preis von 35 Dollar an, während ich das äquivalente Produkt von Nature Physics bei der gewinnorientierten Aktiengesellschaft Springer-Nature für 8,99 Dollar kaufen kann. Dieses Einzelbeispiel verdeutlicht, dass die oft kolportierte Formel "gemeinnützig= preiswert und gewinnorientiert=teuer" nicht immer zutrifft.
Wir sollten uns überdies vergegenwärtigen, dass private Wissenschaftsverlage ihren Lesern schon heute kostenlos hochwertige Informationen bieten. So sind beispielsweise die Formate Editorial, World View, Research Highlights, News, Features, Books and Arts, Correspondence, Obituaries, Futures und News&Views bei Nature kostenlos lesbar. Jeder Erdenbürger mit einem Internetanschluss kann sich aus diesen Rubriken ohne Bezahlschranke informieren. Die inhaltliche und journalistische Qualität ist in den meisten Fällen wesentlich höher als im Fernsehen, in der Presse und in den sozialen Medien.
Schlussendlich sollten wir akzeptieren, dass die besten jungen Talente der Wissenschaft mit ihren Füßen schon lange zugunsten des Subskriptionsmodells abgestimmt haben. Hört man sich unter Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern genau um, so stellt man fest, dass die meisten eine Publikation in Science und Nature sowie deren Ablegern als die höchste Form wissenschaftlicher Anerkennung betrachten. Während zum Beispiel der Impact Factor der im Jahr 2008 vom damaligen Herausgeber Eberhard Bodenschatz als "Rising Star" gepriesenen Open-Access-Zeitschrift New Journal of Physics bei 3,6 verharrt, liegen die Impact Faktoren der Subskriptionsjournale PRL bei 8,8 und Nature Physics bei 22!
2. Die These vom kostenlosen Informationsrecht
Wissenschaftler und Geldgeber behaupten oft, die Öffentlichkeit habe ein Recht auf das kostenlose Lesen wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Sie sagen, Wissenschaftler seien überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert, und allen Steuerzahlern müssten deren Schriften deshalb gratis zur Verfügung stehen.
Der Wunsch nach kostenlosen Waren und Dienstleistungen ist so alt wie die Menschheit. Er findet sich im Märchen vom Tischlein-Deck-Dich, in Karl Marx‘ kommunistischem Leitspruch "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen" sowie in jüngeren Debatten um bedingungslose Grundeinkommen und kostenlose Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch das Weltbild vom anstrengungslosen Wohlstand ist keineswegs alternativlos. Eine von Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung geprägte Weltanschauung spiegelt sich meines Erachtens eher in der Volksweisheit: "Was nichts kostet, ist auch nichts wert" wider.
Bei genauerem Hinsehen stellen wir fest, dass sich der Wunsch nach kostenlosen Fachartikeln keineswegs zwingend aus unseren Gesetzen herleiten lässt. Wollte man ein kostenloses Informationsrecht für alle begründen, so müsste diese Herleitung auch die Frage beantworten, wieso einem Musikfreund der kostenlose Eintritt in die Dresdner Semperoper verwehrt wird. Werden doch die Musiker der Dresdner Staatskapelle aus öffentlichen Geldern bezahlt. Und schließlich müsste man im gleichen Atemzug auch erklären, wieso sich das Studium an staatlichen Universitäten in den meisten Ländern der Welt (außer Deutschland) hinter einer Bezahlschranke verbirgt, wo doch die Angestellten aus Steuermitteln finanziert werden.
Ich habe in meinem Bekanntenkreis einmal nachgefragt, ob meine Freunde die Bezahlschranke bei Fachartikeln als ein gesellschaftliches Problem empfinden. Abgesehen von denjenigen, die im Wissenschaftssystem tätig sind und die Open-Access-Diskussion kennen, war sich keiner dieses Problems auch nur bewusst. Das zeugt davon, dass manche Open-Access-Befürworter ein Bild von vermeintlichen Bedürfnissen der Allgemeinheit zeichnen, welches in der Realität gar nicht existiert.
"Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit war es so einfach, an wissenschaftliche Informationen heranzukommen wie heute."
Auch ohne Open Access sind wir dank der Demokratisierung des Wissens durch das Internet von einer kostenlosen Informationsmöglichkeit für Jedermann gar nicht so weit entfernt. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit war es so einfach, an wissenschaftliche Informationen heranzukommen wie heute. Sollte ein wissenschaftlicher Laie ein Interesse an einer Fachpublikation haben, so kann er sie in vielen Fällen über Google oder Google Scholar als Preprint im Internet finden. Er kann dem Autor eine Mail schreiben oder sich Informationen von den Webseiten des Autors herunterladen.
Selbst kostenpflichtige Informationen sind keineswegs so teuer wie oft behauptet. Ich habe am 12. Juni 2019 getestet, wieviel ein Jahresabonnement der Zeitschrift Nature für eine Privatperson kostet und an diesem Tag ein Angebot in Höhe von 113,70 Euro erhalten. Das dürfte ungefähr den jährlichen Ausgaben jedes Deutschen fürs Biertrinken entsprechen und liegt deutlich unter den Gebühren für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Das Abonnement für Science ist noch billiger. Somit ist hochwertiges Wissen für die breite Masse zwar nicht kostenlos, aber bezahlbar.
3. Die These vom enteigneten Wissenschaftler
Eine dritte allgegenwärtige Klage der Open-Access-Bewegung handelt vom bedauernswerten Gelehrten, der seine Urheberrechte an den Wissenschaftsverlag ohne Gegenleistung abtreten müsse. Ich halte auch diese Kritik für wenig stichhaltig.
Leonhard Euler und Daniel Bernoulli haben sich im Jahr 1733 in einem tiefschürfenden akademischen Briefwechsel zwischen St. Petersburg und Basel umfassend über ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgetauscht. Dabei haben sie weder Urheberrechte an Verlage abgetreten, noch unentgeltlich Manuskripte begutachtet.
Selbstverständlich steht es uns Forschern heute frei, unsere neuesten Entdeckungen ebenso wie Euler und Bernoulli mittels handgeschriebenem Brief oder den modernisierten Varianten E-Mail, Preprintserver, Facebook oder Twitter untereinander auszutauschen, ohne auch nur einen einzigen Wissenschaftsverlag in Anspruch zu nehmen. Wie wir wissen, hat sich jedoch in den vergangenen dreihundert Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, dass Verlage diese Dienstleistung professioneller und mit deutlich größerer Reichweite erbringen als die Wissenschaftler selbst. Schließlich bauen Akademiker auch nicht ihre eigenen Autos und Computer. Es ist vor diesem Hintergrund nicht korrekt, beim Überlassen der Urheberrechte von einer Enteignung zu sprechen. Denn dem Überlassen des Copyrights an die Fachzeitschrift Nature stehen beispielsweise die konkreten Gegenwerte einer exzellenten internationalen Sichtbarkeit und einer professionellen journalistischen Aufbereitung gegenüber.
Die These vom enteigneten Wissenschaftler ist mir aus einem weiteren Grund unverständlich. Viele Kolleginnen und Kollegen halten es für ein probates Mittel akademischer Selbstvermarktung, auf die Dienste des Unternehmens Youtube zurückzugreifen und soziale Netzwerke zur Wissensverbreitung zu nutzen. Daran habe ich nicht das Geringste auszusetzen. Allerdings handelt es sich bei Youtube bekanntermaßen weder um eine karitative Einrichtung, noch um eine dem Gemeinwohl verpflichtete Forschungsförderorganisation, sondern um eine Tochter des Internetgiganten Google. Nach inoffiziellen Schätzungen dürfte Youtube mehr Umsatz erwirtschaften als die Verlage Springer-Nature, Elsevier und Wiley zusammengenommen. Für Verfechter der Enteignungstheorie ist es deshalb lohnenswert, einen Blick in Paragraph 10.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu werfen, der die Überlassung der Urheberrechte von Autoren an Youtube regelt. Im Vergleich dazu sind die Urheberrechtsklauseln der vielgescholtenen Wissenschaftsverlage geradezu ein Inbegriff von Freizügigkeit.
Ein dritter Grund für die Fragwürdigkeit der Enteignungstheorie ist die Tatsache, dass bei der Bearbeitung von Industrieaufträgen durch Universitäten und Forschungseinrichtungen die Rechte an den Arbeitsergebnissen in der Regel dem Auftraggeber überlassen werden. Die Gegenleistung des Auftraggebers ist dann, im Gegensatz zum Publizieren in Fachzeitschriften oder auf Youtube, nicht eine Darstellung in der Öffentlichkeit, sondern eine Bezahlung.
Fasse ich die Sicht auf Open Access aus einer freiheitlichen Perspektive zusammen, so komme ich zu dem Schluss, dass dieses Publikationsmodell eine Bereicherung der Veröffentlichungskultur sein kann, sofern es auf Freiwilligkeit beruht. Wenn die Open-Access-Idee hingegen dazu eingesetzt wird, Unternehmertum zu behindern, konstruierte öffentliche Meinungen zu verbreiten und Wissenschaftler in der Wahlfreiheit ihrer Publikationsmittel einzuschränken, dann steht eine gut gemeinte Idee auf tönernen Füßen.