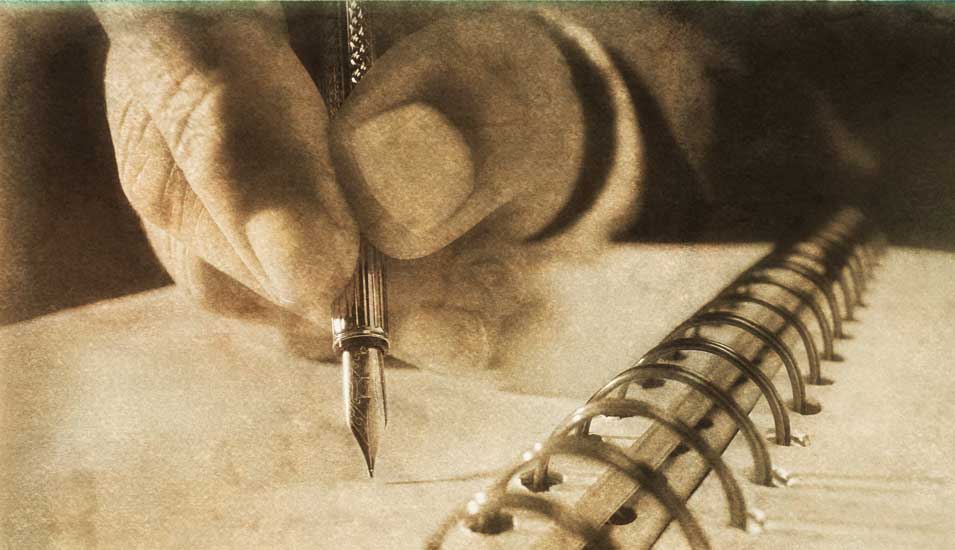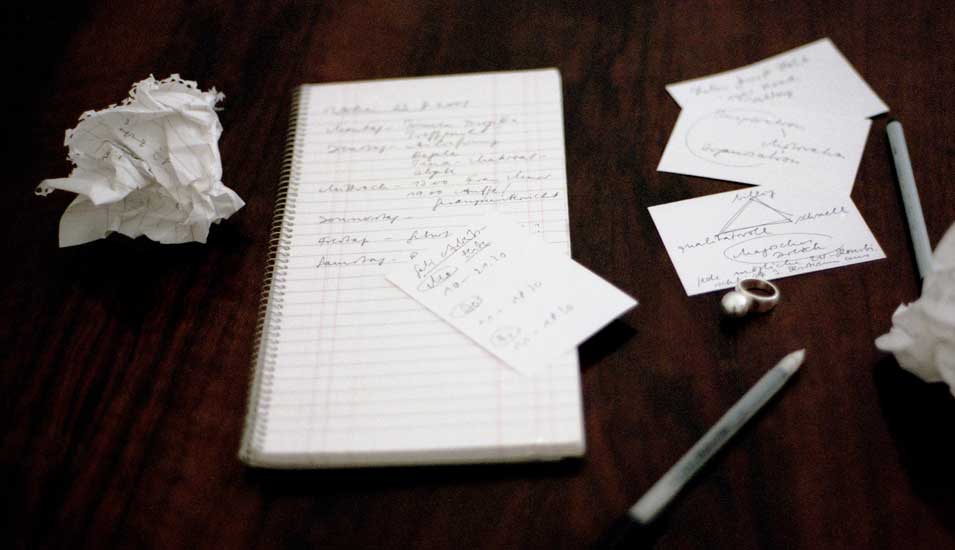
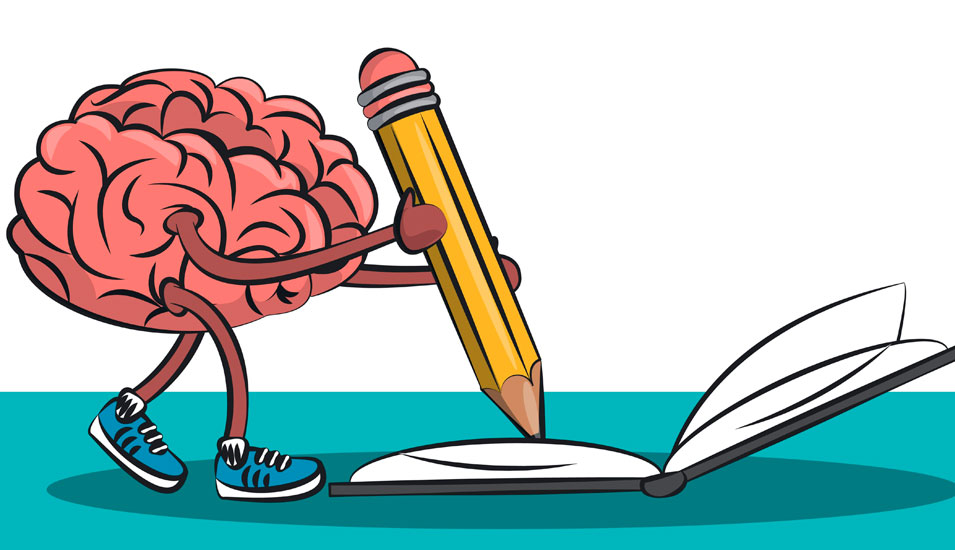
Neurowissenschaften
Warum wir wieder mehr mit der Hand schreiben sollten
Forschung & Lehre: Mit der Digitalisierung nimmt der Anteil dessen, was wir mit der Hand schreiben, immer weiter ab. Wissenschaftlichen Studien zufolge scheinen wir uns damit langfristig keinen Gefallen zu tun. Warum?
Henning Beck: Das Schreiben von Texten mit der Tastatur ist verlockend. Wir haben in wesentlich kürzerer Zeit eine viel größere Menge an Informationen im System, die wir unkompliziert korrigieren, umstellen, streichen und jederzeit aufrufen können. Aber genau das ist der Haken. Denn wir neigen beim Tippen dazu, das Gehörte einfach 1:1 aufzuschreiben, ein rein auditiv motorischer Prozess. Beim Schreiben mit der Hand selektieren wir dagegen direkt und überlegen uns, was wir aufschreiben und was nicht. Dafür müssen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und das können wir nur, wenn wir den Inhalt nicht nur hören, sondern auch verstehen. Die Handschrift schließt einen Denkprozess ein, der etwa beim Tippen an der Tastatur wegfällt. Hinzu kommt, dass wir digital Gespeichertes oft doch nicht nachlesen, was schlecht ist, weil uns die Informationen nicht nur in einem bestimmten Moment fehlen, sondern wir auf diesen auch keine künftigen Gedankengänge aufbauen können.

F&L: Langsamer tippen, Problem gelöst?
Henning Beck: Leider nein. Beim analogen Schreiben kommt noch etwas ganz Wichtiges dazu: Das ist die räumliche Komponente. Wir schreiben auf einen bestimmten Block, vielleicht ist er bunt, vielleicht ist oben rechts auf der Seite ein Kaffeefleck. Mit solchen Details verknüpfen wir unbewusst die Inhalte auf dem Papier und können uns besser an sie erinnern.
F&L: Damit wäre auch die Person weiter im Nachteil, die mit ihrem Surface-Pen auf den Touchscreen schreibt.
Henning Beck: Ganz genau. Zwar sollte sie sich durch die Schreibbewegung deutlich besser als beim reinen Tippen an das Geschriebene erinnern können, aber auch sie schreibt immer nur auf eine Scheibe. Aus diesem Grund hat sich meiner Meinung nach auch das E-Book nicht richtig durchgesetzt. Gerade bei Sachbüchern sind E-Paper für mich keine Option. Ich kann mir die Inhalte einfach besser merken, wenn ich ein Buch in den Händen halte. Dann erinnere ich mich zum Beispiel, dass eine Information in der Mitte des Buches stand oder auf der Seite, an die ich mir ein Eselsohr gemacht habe. Anbieter von E-Books versuchen mit digitalen Lesezeichen ähnliche Effekte zu erzielen, aber die dreidimensionale Komponente können sie nicht ersetzen.
F&L: Wie erforschen Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler solche Effekte des Schreibens?
Henning Beck: Unsere Studien sind eng verbunden mit anderen Wissenschaften, ganz zentral der Psychologie. Über bildgebende Verfahren wie der funktionellen Magnetresonanztomographie untersucht man, welche Hirnareale bei der Verarbeitung von Sprache für welche Aktivitäten zuständig sind – beim Schreiben mit der Hand, beim Tippen oder auch beim Lesen. Dabei ist nie nur eine Hirnregion beteiligt. Sprache aktiviert immer mehrere Areale, denn sie ist viel mehr als eine reine Aneinanderreihung von Wörtern. Wir denken in Mustern, Bildern und Geschichten. Dafür nehmen wir Laute auf, verarbeiten sie zu Wörtern, kombinieren sie und bilden neue Formulierungen, während wir die Informationen mit Erinnerungen an Erlebnisse und Räume verbinden. Man misst also immer die Vernetzung verschiedener Hirnareale und die Veränderung ihrer Aktivität.
F&L: Ist das digitale Schreiben und Lesen dem Analogen in anderen Aspekten voraus?
Henning Beck: So direkt nicht, aber durch die digital verfügbaren Informationen biete ich meinem Gehirn natürlich eine enorme Fülle an Lernstoff. Den muss ich dann allerdings auch verarbeiten. Darüber hinaus können Informationen wunderbar multimedial aufbereitet und mit anderen geteilt werden. Das halte ich für einen Fortschritt, von dem natürlich auch die Wissenschaft profitiert – bei der Recherche oder in der Zusammenarbeit mit internationalen Projektpartnern.
"Das Gehirn ist keine Festplatte, auf die wir Inhalte spielen, die automatisch gespeichert sind."
F&L: Der Mensch hat sich technologischen Veränderungen mit einiger Verzögerung immer wieder angepasst. Gehen Sie davon aus, dass sich auch die Lerneffekte beim digitalen Schreiben im Laufe der Jahre verändern werden?
Henning Beck: Das ist schwierig einzuschätzen. Sicherlich passt sich das Gehirn immer an Reize an, mit denen es stimuliert wird. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass die Handschrift auch in der Zukunft keine unwichtige Rolle spielen wird. Vielmehr wird es darum gehen müssen, sogenannte "Hybrid-Formen" weiterzuentwickeln, die analoge und digitale Sprache verbinden. Schon heute können Wörter, die wir mit einem Surface-Pen schreiben, sofort in eine gewünschte Schriftart umgewandelt werden. Aktuell wird digitale Software in der Bildung leider oft noch zu unbedarft eingesetzt.
F&L: Was kritisieren Sie am Einsatz von digitaler Software in der Bildung?
Henning Beck: Digitalisierung bedeutet nicht Tablets und WLAN ins Klassenzimmer zu holen und das, was man vorher auf eine Tafel geschrieben hat, als Powerpoint-Präsentation abzuspeichern. Das Gehirn ist keine Festplatte, auf die wir Inhalte spielen, die automatisch gespeichert sind. Es ist wichtig, wie wir mit diesen Informationen umgehen. Das Bildungssystem will schnell und effizient sein, aber die Wissensaufnahme ist nicht schnell und effizient. Sie braucht Zeit. Interessant finde ich auch, dass stark digitalisierte Länder teils wieder zum Analogen zurückkehren. In den USA zahlen einige Eltern viel Geld dafür, dass ihre Kinder auf "analoge Schulen" gehen. Ich habe auch schon den Begriff des "Deutschen Ansatzes" in der Bildung gehört.
F&L: Statt hybriden Lernformen doch zurück zum Analogen?
Henning Beck: Das nicht, aber wir sollten nicht digitalisieren, was analog besser funktioniert – auch nicht um Lehre spannend zu machen. Was am Anfang noch "cool" ist, nutzt sich schnell ab. Wichtiger ist, Geld in gute Lehrkräfte zu stecken, die nicht zu schnell Antworten liefern, sondern provokante Fragen und Thesen in den Raum werfen, die zum Denken anregen. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Geschichtslehrer, der einmal mit den Worten in die Klasse kam: "Leute, ich bin Papst!" Anschließend sollten wir ihm helfen, den Gang nach Canossa auszutüfteln. Oder nehmen wir die Wörter "Brexit" und "Selfie". Ich musste sie nicht mehrmals hören. Ich habe sie mir gemerkt, weil sie etwas in mir ausgelöst haben. Über solche Prozesse müssen wir noch mehr erfahren. Das Gehirn hat einige Tricks auf Lager.
F&L: Fühlen Sie sich von der Bildungspolitik überhört?
Henning Beck: Persönlich habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich war immer wieder bei pädagogischen Tagen an Schulen oder didaktischen Fortbildungen dabei. Insgesamt würde ich mir aber noch einen stärkeren Austausch zwischen Neurowissenschaft, Psychologie, auch Sozialwissenschaft und Pädagogik wünschen.
F&L: Im Februar gehen Sie mit einem neuen Buch an die Öffentlichkeit. Haben Sie es mit der Hand geschrieben?
Henning Beck: Ich habe mir tatsächlich erst Notizen mit der Hand gemacht. Die Struktur für jedes Kapitel habe ich auf einem DIN-A5 Blatt entwickelt – ich schreibe klein. Ich habe Aspekte notiert, miteinander verbunden, sortiert. Erst wenn ich das Kapitel vor mir sehe, setze ich mich an den Laptop. Dabei geht es dann nur noch ums Abtippen. Die Denkarbeit spielt sich vorher ab.