

Plädoyer für die Präsenz
Die unbedingte Universität in der Digitalisierung
Die Digitalisierung hat während der Pandemie deutlich an Fahrt gewonnen. Auch die Universitäten waren und sind dazu gezwungen, den Studierenden Online-Lernangebote zur Verfügung zu stellen. Der Wissenschaftsrat hat hierzu am 11. Juli "Empfehlungen zur Digitalisierung in Lehre und Studium" veröffentlicht. Das Gutachten weist auf eine Reihe wichtiger Baustellen hin, die in den nächsten Jahren zu schließen sind. Hierzu gehören unter anderem eine bessere technische und finanzielle Ausstattung der Universitäten, die intensivere Verwendung von "Open Educational Ressources" (OER), neue didaktische Konzepte für die Lehre sowie Schulungen für Studierende und Lehrende. Alles das ist richtig und wichtig. Das Gutachten zitiert allerdings auch Dirk Baecker, demzufolge Digitalisierung nicht nur ein technischer Vorgang ist, sondern eine "neue Epoche" einleitet, die einen tiefgreifenden und alle Lebensbereiche umfassenden Wandel beinhaltet. Digitalisierung ist weit mehr als Technologie, sie reicht in ihrer gesellschaftlichen Relevanz über schnelles Internet, Videokonferenzen und künstliche Intelligenz hinaus und muss angemessen als ein umfassender sozio-technischer Umbau sozialer Praxis, kultureller Formen und Formate sowie gesellschaftlicher Realität verstanden werden. Sie berührt nahezu alle Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der demokratischen Praxis und der sozialen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen moderner Gesellschaften. Sie definiert das Selbstverständnis von Menschen und die Bedeutung sozialer Gemeinschaft neu. Digitalisierung ist so verstanden eine allumfassende und rasante Restrukturierung von Realität. Digitalisierung ist quasi Modernisierung auf Steroid.
Was die Universität heute leisten muss
Universitäten stehen heute vor der Herausforderung, junge Menschen auf diese neue, dynamische und unsichere Welt voller Chancen und Herausforderungen vorzubereiten und mit ihnen das dazu notwendige Reflexions-, Handlungs- und Mitgestaltungswissen zu erarbeiten. Sie können sich dabei noch weniger als bisher auf den Betrieb von berufsbefähigenden Studiengängen beschränken, da wir nicht mehr wissen können, welche Berufsbilder in zehn oder zwanzig Jahren überhaupt noch existieren. Mehr als früher muss es zukünftig darum gehen, Absolventen und Absolventinnen dazu zu befähigen, mit Wandel, Unsicherheit und Komplexität verantwortungsvoll, aber auch engagiert und reflexiv umzugehen.
- Wandel: Universität muss Studierenden die Fähigkeit mitgeben, sich der Herausforderung lebenslanger Lernprozesse zu stellen. Nicht die Beherrschung eines fest umrissenen Wissensbestandes, sondern die Fähigkeit, eigene Grenzen des Wissens zu erkennen und zu verschieben, sollte als eine zentrale Fähigkeit von Absolventen und Absolventinnen verstanden werden. Es geht darum, Studierende in die Lage zu versetzen, sich kontinuierlich in neue Prozesse einzudenken und auf neue und konkurrierende Wissensformen einzulassen, ohne den Verlust von Sicherheit und Stabilität als persönliche Beschädigung empfinden zu müssen.
- Unsicherheit: Mit der rasanten Veränderung gesellschaftlicher Wissensbestände geht die Notwendigkeit einher, mit subjektiven wie gesellschaftlichen Überforderungserlebnissen und Verunsicherungen umgehen zu können. Es geht für Universitäten darum, Studierenden das konzeptionelle und methodische Handwerkszeug zu vermitteln, dieser Herausforderung gerecht werden, sich in einer rasant wandelnden und zunehmend komplexen Welt zurechtfinden und Wandel als Chance begreifen zu können. Universität sollte dazu verstärkt den selbstbestimmten Umgang mit Wissensformen, Deutungsangeboten und Gestaltungsansprüchen unterstützen und die persönliche Entwicklung als relevanten Aspekt von Bildung betonen. Bildung ist mehr als Wissensvermittlung; sie ist Befähigung zum Umgang mit Wissen.
- Komplexität: mit dem rasanten Wandel von Gesellschaft geht auch ein Wandel von Wissensordnungen einher. Es braucht eine Entsäulung von Wissen und die Betonung der Fähigkeit, sich neue und heterogene Wissensgebiete zu erschließen. Absolventen und Absolventinnen müssen multilingual in dem Sinne werden, dass sie die Sprache anderer Disziplinen zumindest verstehen können. Teamarbeit sowie inter- und transdisziplinäre Projekte erhalten hier eine neue Bedeutung als notwendiges Instrument, um mit epistemischer Komplexität umgehen zu können.
- Verantwortung: Die Gestaltung des Wandels verlangt nach gleichzeitig risikobereiten und verantwortungsvollen Gesellschaftsunternehmerinnen und -unternehmern. Es braucht sowohl in den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften als auch in den Fächern Jura und BWL kreative und unkonventionelle Problemgestalter und -löserinnen, die das noch nicht Gedachte denken, das noch nicht Gemachte tun und das Unmögliche möglich machen. Verschulung und Modularisierung müssen auf ein Maß beschränkt werden, das Raum für kreative Entfaltungen der Studierenden und individuelle Projekte lässt.
Universitäten sind Orte des gesellschaftlichen Aufbruchs und des Aufbegehrens der nächsten Generation gegen gesellschaftliche Missstände. Die "unbedingte Universität" (Jacques Derrida) ist ein Raum des freien Denkens, der Kritik und des Aufbruchs. Sie ist dafür da, Neues auszuprobieren und sich an etablierten Autoritäten zu reiben. An den Universitäten knüpfen Studierende Kontakte und bilden Netzwerke, von denen sie häufig noch über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg profitieren. Die Universität der digitalisierten Gesellschaft droht dieses Versprechen immer weniger einlösen zu können. Bereits im Zuge der Bologna-Reformen und der Ablösung von Diplom- und Magister- durch verschulte Bachelor- und zunehmend berufsbezogene Masterstudiengänge haben Universitäten an Freiraum für Eigensinn und kritisches Denken eingebüßt. Die breite Einführung von Online-Angeboten und die pandemiebedingte beschleunigte Verlagerung des kommunikativen Raumes in die Welt der Bildschirme verschärft die Bedrohung der Universitäten als integrativen Ort der Entwicklung gesellschaftlicher Utopien. Sie droht universitären Raum sozial und intellektuell zu entleeren.
Drei konkrete Herausforderungen
Um dieser Gefahr zu begegnen müssen drei konkrete Herausforderungen angegangen werden: Herausforderung Nummer eins ist die Finanzierbarkeit von Digitalisierungsmaßnahmen für die Universitäten, die Lehrenden und die Studierenden. Die Anschaffung des technischen Equipments, das es braucht, um inklusive Online-Lehre zu gestalten und an dieser teilnehmen zu können, ist kostenintensiv. Sie erfordert gute Kenntnisse über den Stand sowie die Entwicklung von Technik, um bereits bei der Anschaffung der Geräte berücksichtigen zu können, welche Funktionen diese bieten müssen und wie lange die in Anspruch genommene Soft- und Hardware noch aktuellen Standards genügen kann. Es muss qualifiziertes Personal zur Verfügung stehen, das die Digitalisierung und die in diesem Prozess zu fällenden Entscheidungen begleitet und die mit der Technik Arbeitenden unterstützt. Weder Lehrende noch Lernende können dies zusätzlich zu ihrem regulären Workload auf einem hohen Qualitätsniveau leisten.
Ein weiteres Problem ist der Verlust der Universität als sozialem Raum. Bildung erfordert einen Ort, an dem sich junge Menschen begegnen, kennenlernen, sich entwickeln und eine Meinung bilden sowie im Zusammenschluss mit anderen lernen und politische Interessengruppen formieren können. Der universitäre Raum lebt vom Diskurs und von multiplen Perspektiven. Junge Menschen brauchen das Miteinander, um sich über Lerninhalte auszutauschen und diese gemeinsam zu bewältigen, sich gegenseitig zu motivieren und zu unterstützen und um gemeinsam Lernziele zu erreichen. Sie müssen miteinander über ihre Probleme im Studium – sowohl mit dem Lernstoff als auch mit Dozierenden – ebenso wie über ihre Pläne und Ziele für die Zukunft sprechen können. Die Verlagerung in den digitalen Raum erstickt dieses Potenzial. Der Verlust der Universität als Raum für das soziale Miteinander bedeutet daher nicht nur die Vereinsamung der Studierendenschaft, die in vielen Fällen im Laufe der Pandemie aufgrund von mangelnder Motivation oder der fehlenden Unterstützung durch Mitstudierende zu einer vorzeitigen Beendigung des Studiums geführt hat. Er hat auch zur Folge, dass jungen Studierenden die Chance genommen wird, Ausgangspunkt neuer Impulse für die Entwicklung der Gesellschaft zu sein. Er nimmt der Gesellschaft damit das Versprechen auf ein besseres Morgen.
"Die digitale Lehre droht durch ihre Verlagerung in den Online-Raum zu einem Konsum-Produkt zu verkommen."
Die digitale Lehre droht durch ihre Verlagerung in den Online-Raum drittens zu einem Konsum-Produkt zu verkommen, das dem Anspruch einer engen Verzahnung von Forschung und Lehre immer weniger gerecht wird. Dozierende haben sich in den vergangenen drei Jahren der Pandemie die technischen Fertigkeiten angeeignet, mit Videoprogrammen, guter Ausleuchtung und wohl gesetzten Texten Wissensinhalte medial anspruchsvoll aufzubereiten. Ehemals neunzigminütige Vorlesungen werden in maximal zehn Minuten lange Wissenspartikel aufgeteilt, die in perfekt formulierten Sätzen den Stand des Wissens referieren. So weit so gut. Die technologischen Innovationen kommen allerdings selten umsonst. Mit perfekt gestalteten Videos geht häufig ein Verlust an Dialog und Widerspruch einher. Mit einem Video diskutiert man nicht. Man spielt es kurz vor der Klausur und am Besten in doppelter Geschwindigkeit (Stichwort: Lernbulimie) ab, ohne die Inhalte weiter zu hinterfragen. Universität braucht aber gerade keine Perfektion. Sie braucht die strittig entstehenden und noch unfertigen Gedanken, den Widerspruch und die Auseinandersetzung. Dafür sind nicht perfekte Videos, sondern der imperfekte soziale Raum mit seinen Fragen, Diskurs und Kritik entscheidend.
Mit dem bevorstehenden Wintersemester und den wieder steigenden Infektionszahlen steht zu befürchten, dass wir in der digitalen Welt verhaftet bleiben und dass die unbedingte Universität zu einer fernen Utopie wird. Lernangebote werden zu einem großen Teil wieder online stattfinden und dazu führen, dass Flure der Universitäten verwaist, Mensen leer und die Seminare kaum besucht sein werden. Die positiven Effekte der Digitalisierung wie die erleichterte Teilnahme an Lernangeboten für Menschen mit Behinderungen, Berufstätige und Alleinerziehende drohen mit dem Preis einer Entleerung der Universitäten als sozialem Raum und einer Bedrohung der Existenz der Universität als Ort gesellschaftlicher Utopien bezahlt zu werden.
"Die positiven Effekte der Digitalisierung drohen mit dem Preis einer Bedrohung der Existenz der Universität als Ort gesellschaftlicher Utopien bezahlt zu werden."
Vor dem Hintergrund dieser Gefahr richten wir einen dringenden Appell an alle Universitätsleitungen sowie die Politik, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um analoges Lernen und Streiten über Gesellschaft und Politik, über Ideen, Beziehungen, über die Vergangenheit und die Zukunft weiterhin zu ermöglichen und das Abdriften in die Sterilität einer digitalen Universität zu verhindern. Eine demokratische und plurale Gesellschaft braucht kluge Köpfe und streitwillige Partizipierende, die eben diese gestalten und prägen. Schützen wir die Universitäten als Raum für persönliche und gesellschaftliche Entwicklung, indem wir den Schutz der Schutzbedürftigen und die Unbedingtheit der Universität miteinander ins Benehmen setzen.
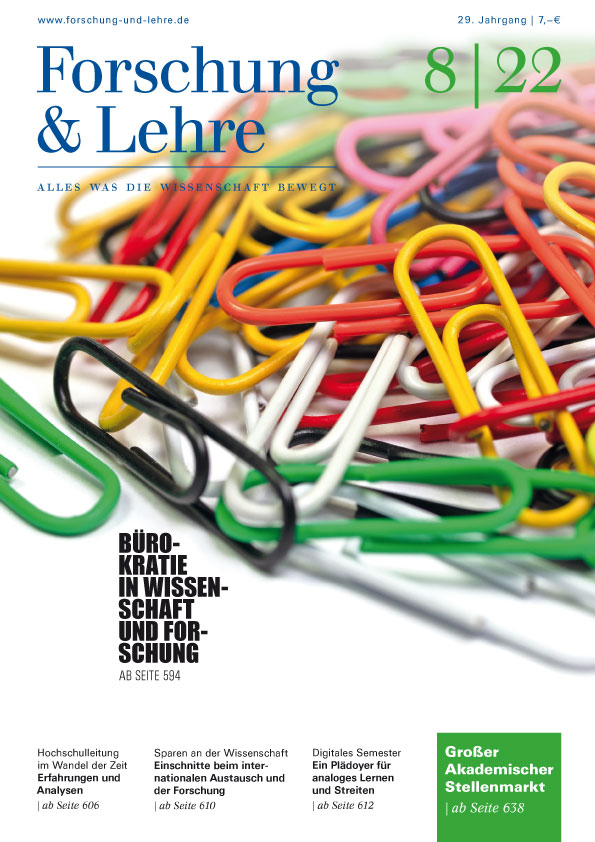


0 Kommentare