

Wissenschaftlertracking
"Das Schicksal von Open Science steht auf dem Spiel"
Die Rede ist nicht von einer harmlosen Sache. Was der – jedem Interesse an Skandalisierung unverdächtige – DFG-Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme (kurz: AWBI) in seinem Informationspapier "Datentracking in der Wissenschaft" für das deutsche Wissenschaftssystem klar anspricht, ist nicht einfach ein Datenschutzleck. Vielmehr werden Wege einer systematischen Abschöpfung und Ausbeutung digitalen Forscherhandelns deutlich, durch welche die rapide wachsende Abhängigkeit der öffentlich getragenen Wissenschaft von Großverlagen eine neue Gefahrenstufe erreicht. Eine bestehende Konfliktlage verschärft sich. Jetzt geht es nicht länger nur um Kosten – bekanntlich hat ein Oligopol von Datenverlagen seit Jahren mit überteuerten Lizenzen, zuletzt Open Access-Lizenzen, die wissenschaftlichen Bibliotheken massiv unter Druck gesetzt. Nun aber erschleicht es sich unter dem Deckmantel des "Schutzes" lizensierter Inhalte die Datenspuren des Wissenschaftlerhandelns selbst. Zum Zweck der Vermarktung. Große Player greifen absichtsvoll die Integrität des wissenschaftlichen Austauschs an. Sie betrachten den gesamten intellektuellen Zyklus staatlich getragener und damit freier Forschung als ihr künftiges Produkt.
"Große Player betrachten den gesamten intellektuellen Zyklus staatlich getragener und damit freier Forschung als ihr künftiges Produkt."
Wo liegt das Problem?
Verlage haben ihr Geschäftsmodell verändert. Sie verkaufen nicht nur Digitaldienste für den wissenschaftlichen Informationsbedarf, sondern nun auch die Daten, die sie beim Betrieb dieser Dienste über das Forscherhandeln gewinnen. Content war gestern. Das neue Geschäftsfeld sind Datenanalysen auf Wissenschaftler-Datenspuren. Die Erstellung und Vermarktung der hierfür notwendigen Klick-Umgebungen, die das Publizieren, aber auch Forscherkommunikation und Forschungsdatenmanagement zunehmend überspannen, ist schon in vollem Gang. Das Wissenschaftssystem selbst, allem voran die Bibliotheken, haben die Entwicklung mit forciert – auch aus der Not heraus, nicht ähnlich gut und schnell eigene Dienste, Forschungsumgebungen und Vernetzungen entwickeln zu können wie privatwirtschaftliche Akteure. Flankierend wird die Digitalisierung der Information unter dem suggestiven Titel "Offenheit" auch wissenschaftspolitisch massiv gefördert, jedoch bislang ohne realistisches Zielbild. Dabei hat man sich klassischer Medien (sowie damit verbundener Marktpartner und Geschäftsmodelle) weitgehend entledigt. Der digitale Wandel wurde dabei als primär technische Angelegenheit missdeutet. Den globalisierten Kampf um gewinnträchtige Märkte, den diese neuen Formen der Wertschöpfung bieten, erkannte man nicht. So sind jetzt die virtuellen Nutzerumgebungen, die man teils öffentlich mitfinanziert hat, zur Lebendfalle für Forschende geworden.
Schon als Leserin bin ich in diesem Universum "Laborratte", wie es in einem FAZ-Beitrag zum Thema heißt (Jörg Brembs, Konrad Förster u.a.: Auf einmal Laborratte, F.A.Z vom 2. Dezember 2020). Bei der Lektüre eines Nature-Aufsatzes "tracken" etwa 70 verschiedene Analyse- und Profiling-Tools der Verlage selbst sowie großer und kleinerer Third Parties (die ihrerseits Daten mit auf dem Markt verfügbaren anderen Daten verknüpfen) wer ich bin, wie ich klicke, wie schnell ich tippe, was ich tue (und was nicht). Auch der Versuch, das Tracking zu unterbinden, ist ein Merkmal, das man gesondert trackt. Aber natürlich sind individualisierte Profile nur ein Teilziel. Mehr noch sind Netzwerkstrukturen, Gruppendynamiken, Forschungstrends als Ziele für Analysen attraktiv.
Über die bei großen Verlagen obligatorische Publishing-Software (also Plattformlösungen für die gesamte Redaktionskette, Begutachtung einschließlich), äußert sich der DFG-Ausschuss nicht. Auch hier ist Schlimmes zu vermuten. Unerbittlicher Zug der Zeit: Ohne eigenes – voraussetzungsvolles und zeitaufwändiges – Verändern der Voreinstellungen auf den Seiten des gerade genutzten virtuellen Dienstes, fließen die Feindaten aus der wissenschaftlichen Produktionskette mehr oder weniger in Echtzeit an transnationale Datenkonzerne ab (s. Jan-Martin Wiarda mit Björn Brembs und Renke Siems im Oktober 2020: "Eine Gefährdung der Freiheit von Forschung und Lehre"). Und so werden Auswertungen über Science made in Germany zum globalen Geschäftsgut.
"Kommerzielle Broker kaufen die Wissenschaft. Und zwar nicht nur ihre Ergebnisse, sondern das Prozesswissen."
Unlängst wurde gemeldet, die Verlagsgruppe Springer-Nature habe eine Milliarde Euro private Investitionsmittel eingeworben, um "das längerfristige Potenzial von Open Science zu nutzen" (Börsenblatt). Das lässt ahnen, wie groß im genannten Feld die Gewinnspannen sind. Kommerzielle Broker kaufen die Wissenschaft. Und zwar nicht nur ihre Ergebnisse, sondern das Prozesswissen. Also Verhaltensmuster en gros und en detail. In Echtzeit.
Was ist geschehen und wer ist beteiligt?
Daten über Wissen, wissenschaftliche Entwicklungen und wissenschaftliche Akteure werden zum neuen Geschäftsfeld, hält der AWBI trocken fest. Der maßgeblich mit Bibliotheks-Experten besetzte Ausschuss will nicht ausschließen, dass Trackingdaten verlagliche Leistungen für die wissenschaftliche Nutzung auch verbessern können. Mag sein. Sicher wirft in den Führungsetagen wissenschaftlicher Einrichtungen hier und da auch jemand gern einen Blick auf von externen Anbietern feilgebotene Analysen über die Forschung im eigenen Hause. Aber selbst hierzu bedarf es keinesfalls eines Zugriffs auf die Mikroebene des Verhaltens einzelner Forscherinnen und Forscher – dies ist aus der Forschung zur Evaluation wissenschaftlicher Leistungen lange bekannt. Den Schaden wiederum, den Mikro-Monitoring mit Blick auf die Motivation von Forscherinnen und Forschern verursacht, wiegen etwaige Vorteile keinesfalls auf. Schon länger warnen der Wissenschaftsrat und andere Beobachter des Gesamtsystems vor Fehlanreizen, die zum Beispiel Indikatorensysteme in der sensiblen Welt der Spitzenforschung setzen. Vor allem aber: Man fragt nicht in hinreichender Breite die Wissenschaftler selbst, hier mitzuentscheiden, wohin die Reise geht. Vielmehr ersetzt Technokratie eine hinreichend kritische sowie – pardon! – wissenschaftspolitisch auch hinreichend zugespitzte Diskussion.
Denn wie kam es zum Status Quo? Hier gilt es, unangenehme Wahrheiten zu bekennen. Die digitale Transformation der Informationsversorgung ist in Deutschland ganz wesentlich zwischen den wissenschaftlichen Bibliotheken bzw. ihrem Verband, ihren Trägereinrichtungen (welche die Bedeutung dieses Infrastrukturressorts notorisch unterschätzen), der DFG als (Haupt-) Zuwendungsgeberin sowie nicht zuletzt dem BMBF ausgestaltet worden. In dieser Konstellation schlug man sich auch frühzeitig auf die Seite der wenigen, aber stimmgewaltigen Akteure, die Open Access ("OA") als Heilmittel nicht nur für bestimmte Kostenprobleme, sondern für das wissenschaftliche Publizieren insgesamt meinten ausmachen zu können. In den durch die HRK verantworteten DEAL-Verhandlungen über nationale Wissenschaftslizenzen mit den Großanbietern Elsevier, Springer-Nature und Wiley wurde dann daran mitgewirkt, ein neues, Autorinnen und Nutzer individualisierendes Rechnungslegungssystem zu etablieren. So schuf die Wissenschaftspolitik ein Gesamtregime, in welchem das Publizieren faktisch in einer Weise evaluiert wird, die dem Datenbedarf der Großverlage direkt zuarbeitet. Dass "OA" sich dabei auf einen exklusiven Zugang für die Nutzer wissenschaftlicher Bibliotheken verengt, OA-Publikationen einem Laienpublikum (oder Lesenden im Ausland) also gerade nicht "offen" zur Verfügung stehen, sei nur am Rande erwähnt.
Jetzt müssen alle Beteiligten einräumen, dass der Lizenzkauf bezieungsweise Verlagsverträge, die bislang geschlossen wurden, das Thema Wissenschaftlertracking vernachlässigen. Das AWBI-Papier ruft nach dem Gesetzgeber. Dies lenkt von der Frage ab, warum die Bibliotheksleitungen, die DFG und nachweislich auch DEAL es versäumt haben, die Nutzerinnen und Nutzer zu schützen: in beiden bereits abgeschlossenen Verträgen finden sich keine entsprechenden Schutzklauseln. Wer Bibliotheksressourcen nutzt, vertraut aber in die öffentliche Infrastruktur und klickt sich uninformiert und wehrlos in die nachverfolgenden Angebote ein.
Dass verstecktes Wissenschaftlertracking Individualgrundrechte verletzt ("informationelle Selbstbestimmung") liegt auf der Hand. Ebenso müssen öffentliche Forschungseinrichtungen Tracking-behaftete Dienste auch dann ablehnen, wenn diese per Klick Zustimmung zu Geschäftsbedingungen verlangen, die nicht DSGVO-konform sind ("digitale Souveränität"). Darüber hinaus fordert und verbürgt das Grundgesetz die Freiheit der Wissenschaft als Ganzes. Schon jetzt dürften Betroffene von daher Klagemöglichkeiten haben – womöglich sogar gegen die eigene Bibliothek oder Hochschule.
Was ist nun zu tun?
In der entstandenen Situation ist wissenschaftspolitisch kluges Handeln gefragt – und zwar sofort. Die aktuellen und anstehenden Neuverhandlungen der DEAL-Verträge sind ein Beispiel. Den Verhandlungsführern auf Seiten des Wissenschaftssystems muss klar sein: Schiebt man dem Wissenschaftlertracking vertraglich keinen Riegel vor, steht nicht nur die Vision von Open Science auf dem Spiel. Vielmehr steht der freie – verfassungsrechtliche geschützte – Prozess des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns, steht die von Kollegialität und Wettbewerb getriebene Wahrheitssuche in Frage. Denn wieviel mag man noch preisgeben, wenn man weiß, dass jeder Klick im Forschungsprozess beobachtet wird? Welche Informations-, Publikations- und Kollaborationsdienste wird man noch nutzen, wenn man nicht weiß, wer und zu welchem Zweck hier – individualisierbar – Daten aggregiert? Es muss verhindert werden, dass Digitalisierung in eine Entwertung des intellektuellen Handwerks münden: in eine Goldgrube für Datenmakler, die das Produktformat "Offenheit" zum Raubbau an der öffentlichen Wissenschaft nutzen.
"In der entstandenen Situation ist wissenschaftspolitisch kluges Handeln gefragt – und zwar sofort."
Ist die Wissenschaftsfreiheit im Digitalbereich zwangsläufig zu Ende? Die Pfadabhängigkeiten sind unübersehbar bereits da. Die Datenwirtschaft weiß genau was sie will. Augenscheinlich sind die Verantwortlichen auf Seiten des Wissenschaftssystems in der Defensive, haben die Folgen des aktuellen "auf Sicht Fahrens" und die vielfältigen Kommerzialisierungsmöglichkeiten der digitalen Geschäftsmodelle ihrer Vertragspartner schlichtweg übersehen oder verdrängt. Freilich ist noch nicht alles verloren. Es kann und muss – für das gesamte Wissenschaftssystem transparent – ein Schutz vor Verhaltensüberwachung und -auswertung nachverhandelt werden. Und: Die Forscherinnen und Forscher, ihre Fachgemeinschaften und Vereinigungen gehören mit an den Tisch. Dies bleibt ein wichtiges Verdienst des ABWI-Papiers: Niemand kann mehr sagen, es komme im digitalen Wissenschaftswandel nicht eben auch zu Gefahren. Jetzt gilt es, diese Einsicht in kollektive Mitgestaltungsmacht zu verwandeln.
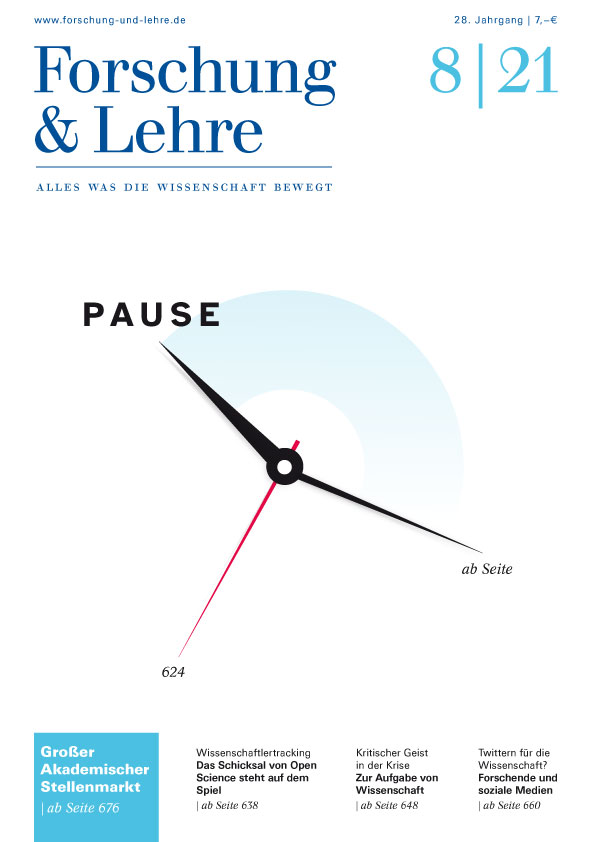


0 Kommentare