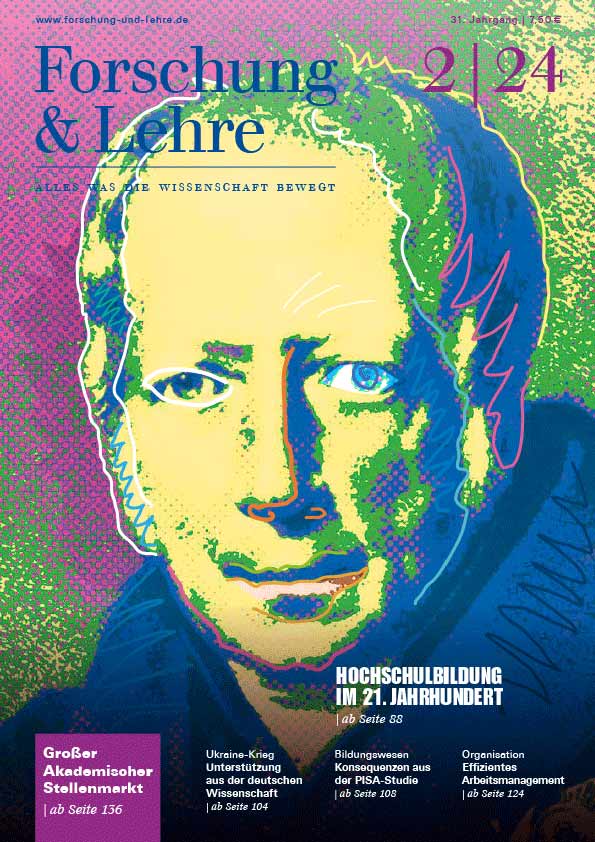Psychische Gesundheit
Wie belastet sind Studierende?
In Teilen der Öffentlichkeit wird Studierenden in der universitären Lebensumwelt eine hohe Lebensqualität mit einem hohen Freiheitsgrad zugeschrieben. Das Studium birgt jedoch auch spezifische Herausforderungen. Die Eintrittsphase in die Universität wird zu Recht als eine kritische Phase in der Entwicklung eines jungen Menschen angesehen (Übergang vom Jugendalter zum Erwachsenenalter). Studieren bedeutet, sich mit den täglichen Anforderungen des universitären Lebens, etwa mit hoher Prüfungsdichte, Anwesenheitspflichten und sich ausweitenden Curricula, und des privaten Lebens auseinandersetzen zu müssen.
Das Gelingen der Bewältigung dieser Anforderungen prägt im besten Fall für das weitere private und berufliche Leben. Es kann jedoch auch zu einer großen Überforderung führen, die sich im Erleben einer starken psychischen Belastung bis hin zu einer psychischen Erkrankung zeigen kann. Diesen Studierenden ist die Teilhabe am gesellschaftlichen und akademischen Leben erschwert. Es ergeben sich Schwierigkeiten in der Lebensführung, der Interaktion mit anderen, verlängerte Studierzeiten bis hin zur Studienunterbrechung oder dem Studienabbruch.
Internationale Datenlage zur psychischen Gesundheit
Die internationale Datenlage zur psychischen Gesundheit und der Existenz von psychischen Erkrankungen ist vergleichsweise mehr als reichhaltig. Es ist unstrittig, dass sich etwa 75 Prozent der psychischen Erkrankungen (Angststörungen, Depressionen) bis zum Alter von 24 Jahren erstmalig manifestieren. Das zeigt sich auch in den Daten zu Studierenden.
Unterschiedliche Primärstudien und Meta-Analysen zeigen, dass ein Fünftel bis ein Drittel der Studierenden unter psychischen Störungen mit Krankheitswert leiden. Die Inanspruchnahme von Hilfsangeboten ist vergleichsweise gering, wie durch Studien gezeigt werden konnte (25 bis 30 Prozent der Betroffenen). Die Gründe hierfür sind vielfältig. Neben der Angst, sich zu öffnen, sind die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, mangelnde Kenntnis über psychische Erkrankungen und das fehlende Wissen über Angebotsstrukturen der Universitäten zu nennen.
Auch fehlendes Wissen über psychische Erkrankungen oder der Umgang damit seitens des Universitätspersonals wäre zu nennen. Studien zeigen, dass psychische Störungen und Suizidalität bei Studierenden häufiger sind als in der Allgemeinbevölkerung. Suizidale Gedanken (Lebenszeitprävalenz) ließen sich bei etwa 25 Prozent der Studierenden nachweisen. Eine Metaanalyse aus 2017 berichtet eine 12-Monatsprävalenz für suizidale Gedanken (10,6 Prozent), Suizidpläne (3 Prozent) und Suizidversuche (1,2 Prozent).
Psychische Störungen bei Studierenden in Deutschland
Bestehende Untersuchungen unterscheiden sich deutlich in Bezug auf Methodik und Vergleichbarkeit. Repräsentative Daten über die psychische Verfassung der deutschen Studierenden werden regelmäßig durch das Deutsche Studierendenwerk in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) bereitgestellt. Im Jahr 2017 gaben in der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks elf Prozent der Befragten an, dass sie unter studienerschwerenden Beeinträchtigungen leiden.
In dieser Gruppe gaben 47 Prozent der Befragten an, dass sich eine psychische Erkrankung als die sich am schwersten auswirkende Beeinträchtigung bemerkbar macht. In der Studierendenbefragung "beeinträchtigt studieren – best2" stellen Studierende mit psychischen Erkrankungen im Befragungszeitfenster (2016) die mit Abstand größte Gruppe unter den studienrelevanten Beeinträchtigten dar.
Hier wurden Studierende bundesweit zu studienerschwerenden körperlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen befragt. 53 Prozent der Befragten gaben an, dass sie am stärksten infolge einer psychischen Erkrankung in ihrem Studium beeinträchtigt seien: Depression (80 Prozent), Angststörung (39 Prozent), Essstörung (16 Prozent) und Persönlichkeitsstörung (12 Prozent). Im Vergleich zur Vorgängerstudie ließ sich insgesamt ein Anstieg von acht Prozent beziffern. Die Interpretation der Daten ist jedoch erschwert, da es sich bei den Angaben um Selbstauskünfte der Betroffenen handelt, wobei in der "best2"-Studie auch nach der aktuellen oder in der Vergangenheit stattgefundenen Inanspruchnahme von psychotherapeutischen Hilfeleistungen gefragt wurde.
"53 Prozent der Befragten gaben an, dass sie am stärksten infolge einer psychischen Erkrankung in ihrem Studium beeinträchtigt seien."
Dr. Rainer Weber, leitender Psychologe der Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Universität zu Köln
56 Prozent der teilnehmenden Studierenden gaben an, aktuell (oder in der Vergangenheit (29 Prozent) in psychotherapeutischer, psychiatrischer oder neurologischer Behandlung (gewesen) zu sein. Laut der aktuellen "best3"-Studie von 2023, die unter etwa 180 000 Studierenden bundesweit durchgeführt wurde, gaben etwa 30 Prozent der Befragten an, unter einer oder mehreren studienerschwerenden Beeinträchtigungen zu leiden.
Psychische Beeinträchtigungen wurden dabei von 65,2 Prozent der Befragten geäußert. Nur 7,9 Prozent der Studierenden, die psychische Beeinträchtigungen als studienerschwerend angaben, berichteten, dass diese Beschwerden von Geburt an bestünden; bei 69,9 Prozent traten diese Beeinträchtigungen erstmalig vor Aufnahme des Studiums auf und bei 22,9 Prozent der Studierenden während des Studiums. 14,8 Prozent der Studierenden mit psychischen Beeinträchtigungen gaben zudem an, Studienabbruchsintentionen zu hegen.
Studium als vulnerable Lebensphase
Dies legt einerseits den Schluss nahe, dass das Studium eine vulnerable Lebensphase darstellt, und andererseits, dass das universitäre Umfeld Faktoren einbringt, die die Entwicklung von psychischen Beeinträchtigungen fördern. Auch der Wunsch nach Beratungs- und Unterstützungsangeboten wurde von der Gruppe der Studierenden mit psychischen Erkrankungen wesentlich häufiger zum Ausdruck gebracht als von jenen, die keine studienerschwerenden Beeinträchtigungen nannten. Die Inanspruchnahme der psychologischen Beratungsstellen wird von etwa 30 Prozent der Studierenden mit Beeinträchtigungen genannt. Die Bereitschaft, Unterstützung tatsächlich nachzufragen, ist bei Studierenden insgesamt jedoch eher schwach ausgeprägt. Das steht im Einklang mit den Daten aus internationalen Studien.
"Die Inanspruchnahme der psychologischen Beratungsstellen wird von etwa 30 Prozent der Studierenden mit Beeinträchtigungen genannt."
Dr. Rainer Weber
Mögliche Erklärungen hierfür sind, dass man nicht beurteilt werden möchte oder dass psychische Erkrankungen und Belastungen eher als ein Zeichen von Schwäche angesehen werden (Selbst- und Fremdstigmatisierung), die insbesondere beim Wettstreit untereinander um bessere Noten, bessere Abschlüsse und eine bessere Karriere keinen Platz haben. Diese Haltung setzt sich oftmals nach dem Studium fort und wird durch die akademische Arbeitskultur, in der Konkurrenz und Wettbewerb um Fördermittel und attraktive Stellen gang und gäbe sind, weiter befördert. Diese universitäre Arbeitskultur, die bereits im Studium erlernt wird, bietet Menschen mit Belastungen, sei es psychisch oder physisch, nur wenige Möglichkeiten, diese offen zu äußern.
Datenreprots der Krankenkassen liefern Hinweise
Neben den Umfragen des Deutschen Studierendenwerks liefern Datenreports von Krankenkassen Hinweise zur psychischen Befindlichkeit von Studierenden. Nach der aktuellen Studie der Techniker-Krankenkasse aus dem Jahr 2023 haben die Belastung der Studierenden und die Anzahl an psychischen Erkrankungen im Vergleich zu den Vorgängerstudien (2011 und 2015) stark zugenommen. Krankenkassendaten bieten jedoch auch nur eine selektierte Betrachtungsperspektive, indem sie nur diejenigen Fälle abbilden können, die im Versorgungssystem tatsächlich vorstellig und mit einer Diagnose versehen werden.
Darüber hinaus wird möglicherweise vor dem Hintergrund langer Wartezeiten auf eine fachpsychotherapeutische Konsultation oder Behandlung der reale Versorgungsbedarf nicht abgebildet. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass jüngere Studierende in der Stichprobe unterrepräsentiert sind. Um als Teilnehmender der Stichprobe gezählt zu werden, ist die eindeutig identifizierbare Mitgliedschaft als Versicherter notwendig. Im Falle einer Versicherung über die Eltern oder einer Mitversicherung über den Ehepartner ist das nicht eindeutig möglich.
Mit Blick auf den eingangs beschriebenen Befund, dass sich etwa 75 Prozent der psychischen Erkrankungen bis zum 24. Lebensjahr erstmalig manifestieren, sind diese Daten nicht leicht interpretierbar. Es lässt sich festhalten, dass die Häufigkeit psychischer Erkrankungen bei Studierenden in Deutschland in bundesweiten Befragungen als hoch und bedeutsam einzuschätzen ist, aber gleichzeitig die gewählte Methodik der Datengewinnung (Querschnittsstudien, Selbstauskünfte anhand einer Liste von Störungsbildern oder selektierter Stichproben) oftmals die Qualität der Aussagekraft einschränkt.
Neben den bundesweit durchgeführten Befragungen und der Analyse von Krankenkassendaten liegen Studien vor, die an verschiedenen Hochschulstandorten zur Frage der psychischen Belastung beziehungsweise Erkrankung von Studierenden durchgeführt wurden (z.B. Mainz, Köln, Berlin, Ulm). Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer noch intensiveren Beschäftigung mit dem Thema der psychischen Gesundheit von Studierenden.
Umgang der Hochschulen mit psychischen Belastungen
Das Thema psychische Gesundheit der Studierenden stellt die Hochschulen vor große Herausforderungen. Der Blick auf die internationale und insbesondere auf die nationale Datenlage zeigt, dass der psychischen Gesundheit von Studierenden ein neuer Stellenwert beigemessen werden muss. Die Daten der aktuellen Befragung des Deutschen Studierendenwerks weisen darauf hin, dass die Studierenden, die ihre psychische Erkrankung während der Zeit des Studiums entwickelt haben, in der Minderzahl sind. Das bedeutet, dass die meisten Studierenden mit psychischer Erkrankung diese mit in das Studium bringen. Hieraus lässt sich die dringende Forderung ableiten, Konzepte jenseits einer psychotherapeutischen Versorgung, die im bundesdeutschen Gesundheitssystem durch die Gesetzliche und Private Krankenversicherung geregelt ist, zu entwickeln. Reine Präventionsangebote reichen für diese Studierenden nicht aus.
"Die Daten (…) weisen darauf hin, dass die Studierenden, die ihre psychische Erkrankung während der Zeit des Studiums entwickelt haben, in der Minderzahl sind."
Dr. Rainer Weber
Um dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden, soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass die Qualität der Aussage (Zeitpunkt des Auftretens der psychischen Erkrankung) eingeschränkt ist. Es ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht verständlich, dass man sich bei der Brisanz der Thematik, die sich in allen internationalen und nationalen Studien zeigt, und der Tatsache, dass es sich darüber hinaus um eine Befragung handelt, die vom BMBF gefördert wurde, keine besseren Daten leistet. Nicht validierte Selbstauskünfte ohne Kontrollfragen (zum Beispiel die Inanspruchnahme von Psychotherapie oder anderen Hilfsangeboten) führen vom Ergebnis her eher in eine Sackgasse. Zudem gibt es noch viel zu wenig Wissen über den Umgang mit internationalen Studierenden im Zusammenhang mit psychischen Belastungen oder Erkrankungen. Befragungen an der Universität zu Köln lieferten besorgniserregende Zahlen (Depression, suizidale Gedanken). Diese Gruppe der Studierenden ist eher sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, über ihre Befindlichkeit zu sprechen oder sich Hilfe zu holen.
In der Regel sind Mitarbeitende an den Universitäten mit den Studierenden beschäftigt, die keine psychologische Aus- oder Weiterbildung vorweisen. Hier wären zum einen dringend standardmäßige Fortbildungsmaßnahmen und regelmäßige Supervisionen anzubieten. Zum anderen braucht es Unterstützungsangebote für die betroffenen internationalen Studierenden, die mit Blick auf die kulturellen Unterschiede von den Studierenden angenommen werden können.
Es ist weiterhin zu wünschen, die Geschlechtervielfalt in neueren Befragungen zu berücksichtigen. Studien weisen auf eine hohe Vulnerabilität für psychische Belastungen unter anderem durch Diskriminierungserfahrungen und psychische Störungen (vor allem Depression) in der Gruppe von Menschen, die sich dem LGBTQIA+-Spektrum zuordnen lassen. Die Datenlage bei Studierenden ist hier eher schmal.
Begriffliche Schärfen in erhobenen Daten oft nicht eingehalten
Aus der Depressionsforschung ist zudem bekannt, dass insbesondere Männer in Fragen des Hilfesucheverhaltens, des Redens über psychische Belastungen oder Erkrankungen weit hinter den Raten für Frauen zurückliegen. Sowohl international als auch national besteht hier eine Forschungs- und letztlich Versorgungslücke bei männlichen Studierenden, insbesondere auch mit Blick auf die Suizidraten. Die weiter oben beschriebenen Daten zeigen auch, dass wir uns sowohl international wie national schwer damit tun, begriffliche Schärfen einzuhalten.
Von einer psychischen Erkrankung oder Störung oder einer Depression oder einer Angststörung sollte man nur dann sprechen, wenn eine lege artis durchgeführte Diagnostik stattgefunden hat. Vielfach werden Stress und Erschöpfung als psychische Erkrankung beschrieben, was falsch ist. Wahr ist, dass Belastungen, Furcht, Sorgen und Stress zunächst einmal normale Reaktionen auf wahrgenommene oder reale Bedrohungen darstellen. Sie werden jedoch nicht mit Diagnosen erfasst. Sie belasten aber trotzdem und die Betroffenen brauchen Entlastung.
Passende Präventionsstrategien erfordern belastbare Daten
Um passende Präventionsstrategien zu verfolgen, ist eine belastbare Datenbasis zwingend erforderlich. Daher sollten an den Universitäten regelmäßig Befragungen zur psychischen Gesundheit von Studierenden durchgeführt werden. In aller Regel liegt den Befragungen zur psychischen Befindlichkeit von Studierenden ein kategorialer Begriff der psychischen Erkrankung zugrunde (gesund versus krank). Für bestimmte Leistungen bzw. deren Finanzierung (zum Beispiel Psychotherapie) ist es notwendig, einen kategorialen Begriff von Gesundheit und Krankheit zu verwenden. Es scheint jedoch Einigkeit darüber zu bestehen, dass psychische Gesundheit nicht nur die Abwesenheit psychischer Erkrankungen bedeutet.
"Daher sollten an den Universitäten regelmäßig Befragungen zur psychischen Gesundheit von Studierenden durchgeführt werden."
Dr. Rainer Weber
Um ein valides Bild der realen psychischen Situation der Studierenden zu erhalten, erscheint ein dimensionaler Ansatz jedoch angemessener. Es stellt sich generell die Frage, ob das Denken in Diagnosen überhaupt sinnvoll ist, wenn es als gesichert angesehen werden kann, dass Diagnosen zur Stigmatisierung beitragen.
Die Gruppe der Studierenden, die sich an der Schwelle zu einer behandlungsbedürftigen Störung befindet, stellt eine mögliche Risikogruppe dar, die epidemiologisch nicht erfasst ist. Gleichzeitig besteht das Risiko einer Verschlechterung der aktuellen psychischen Befindlichkeit aufgrund fehlender oder nicht angenommener Hilfsangebote. Es wäre zu wünschen, dass sich Universitäten zusammenfinden und hier mit den gleichen Messinstrumenten entsprechende Befragungen durchführen, um Vergleichsdaten zu schaffen.