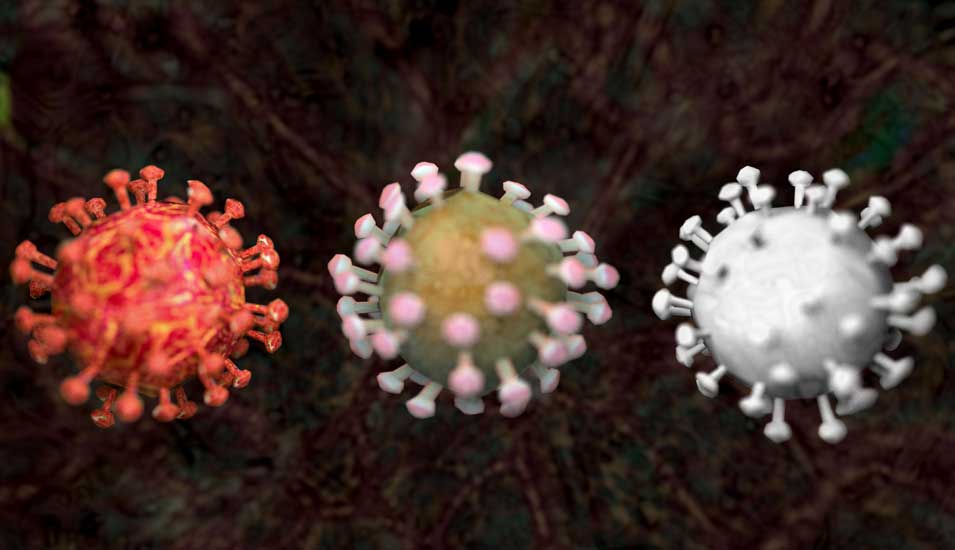Zeit
Woher der Zeitdruck in der Forschung kommt
Forschung & Lehre: Schnelligkeit, sowohl in der Forschung als auch bei der eigenen Karriere, Effizienz, hoher Publikationsdruck kennzeichnen die heutige Wissenschaft. Wie ist es zu diesem Wettlauf mit der Zeit gekommen?
Ulrike Felt: Dafür muss man sich anschauen, wie Universitäten in das gesamte Forschungssystem eingebettet sind. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat Forschung eine ganz neue Form von Zeitlichkeit bekommen, indem das Projekt – die Einheit, die die Forschung organisiert – extrem bedeutsam wurde. Das ist die eine Veränderung. Die zweite ist, dass insgesamt der Diskurs rund um Wettbewerb, Geschwindigkeit, Innovation als treibende Kraft zugenommen hat. Wissenschaft kann nicht losgelöst von der Gesellschaft verstanden werden, und daher werden bestimmte Veränderungen, die wir in der Gesellschaft ausmachen, natürlich auch im Wissenschaftssystem gespiegelt. Das betrifft auch die Vorstellung von Exzellenz und Wettbewerb. Sie beruht auf einer Analyse der Vergangenheit – ob diese zutreffend ist oder nicht, darüber könnte man lange diskutieren –, dass nämlich das System bestimmte Defizite aufweise wie zum Beispiel das, dass Menschen zu schnell in sichere Positionen gelangten. Daraus wurde dann die Vorstellung geboren, dass man mehr Leistung erhalten könnte, indem junge Forscher und Forscherinnen sehr lange in temporären Abhängigkeitsverhältnissen bleiben (müssen). De facto sitzen nun viele auf einer zeitlich befristeten Doktorandenstelle, danach sind die meisten noch eine Zeitlang auf zeitlich befristeten Postdoc-Stellen und schließlich findet ein Ausleseprozess statt, in dem es sehr viele Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen nicht schaffen, eine halbwegs stabile Position im System zu erlangen. Man darf nicht vergessen, der ganze Exzellenzgedanke baut im Grunde genommen darauf auf, dass eine hochgradige Selektion vorgenommen wird. Das heißt ich brauche viele Kandidaten und Kandidatinnen, aus denen ich selektiere. Wir produzieren immer mehr hochqualifizierte junge Menschen, denen aber nur eine relativ geringe Zahl an permanenten Stellen zur Verfügung steht.
"Warten und schnell sein bilden nicht unbedingt einen Widerspruch."
Diese Entwicklungen haben zu einem Zeitdruck im System geführt: Einerseits muss alles sehr schnell gehen und gleichzeitig müssen die Menschen sehr lange warten. Warten und schnell sein bilden hier nicht unbedingt einen Widerspruch. Wir haben dann begonnen, Forschung an Leistung pro Zeiteinheit zu messen und uns darin auf dieser Ebene zu vergleichen. Michael Power bezeichnet das sehr schön als "Audit Society" – nur was gezählt werden kann zählt. Das führte fast zwangsläufig zu Beschleunigung. Ich würde die These vertreten, dass die Wissensproduktion selbst nicht wirklich beschleunigt worden ist, sondern dass sich bestimmte Beschleunigungsphänomene eingestellt haben, die von uns – völlig gerechtfertigt – sozial wahrgenommen werden.

F&L: Bei der Grundlagenforschung spricht man gern vom "langen Atem", der vonnöten sei, damit sich neue Ideen entwickeln können. Wieviel Zeit geben wir der Grundlagenforschung, die Innovationen für morgen hervorbringen soll?
Ulrike Felt: Die Grundlagenforschung braucht einen langen Atem, aber wer hat ihn? Als Wissenschaftler beziehungsweise Wissenschaftlerin in einer festen Position (mit permanentem Vertrag) kann ich mir überlegen, wie ich über Projekte, die ich nacheinander ausführe, einer größeren Frage nachgehe. Insofern kann sich die Grundlagenforschung Zeit verschaffen, auch größere Fragen zu beantworten. Das Problem liegt darin, dass es sich dabei um ein Privileg von Personen handelt, die sich in einer festen institutionellen Position befinden. Hier sind neue Ungleichheiten entstanden. Das zweite ist, dass sich die Vergabe von Fördergeldern zwar nicht explizit, aber implizit an Nützlichkeitserwägungen im weitesten Sinne orientiert, und dies betrifft eher kurzfristige Themenbereiche. Nehmen wir das Beispiel Covid-19: Hier ist sehr schnell relativ viel Geld hineingeflossen, aber erwartet wird auch eine kurzfristige Lösung. Allerdings muss man sich überlegen, wie man damit umgeht, dass andere Forschungsbereiche dann das Nachsehen haben. Es wäre ja naiv zu glauben, dass das Geld, welches wir nun in die Covid-19-Erforschung investieren, nicht bei anderen Forschungsbereichen abgezogen wird. Irgendwann geht die Rechnung nicht mehr auf.
F&L: Brauchen Wissenschaft und Forschung nicht eine eigene Zeitlogik?
Ulrike Felt: Wissenschaft und Forschung sollten über ihre Zeitlogik nachdenken und begreifen, dass Zeit ein ganz wichtiger politischer Faktor ist, mit dem wir Wissenschaft gestalten. Die Tatsache, dass wir Forschung so strukturieren, wie wir es tun, hat implizit die Auswirkung, dass wir nur Fragen stellen, die in diesen Zeithorizonten auch beantwortbar sind. Zeitpolitik ist Wissenschaftspolitik und damit auch Gesellschaftspolitik mit anderen Mitteln. Schaut man sich die gesamte Zeitstruktur analytisch an, entsteht das Problem sehr oft dann, wenn verschiedene Teilaspekte in den Systemen unterschiedliche Zeitlogiken haben. So passen Ausbildungszeiten mit Projektzeiten nicht mehr zusammen und Evaluierungszeiten nicht mit Lebensläufen usw. Wir haben der Zeitlogik zu wenig Bedeutung geschenkt und andere Logiken wie zum Beispiel die Produktionslogik darübergelegt. Wir haben Zeit nicht als ein strukturierendes Phänomen wahrgenommen, das ist die Problematik in dem System. Zeit ist keine unschuldige Kategorie. Was bedeuten eigentlich Drei- oder Fünf-Jahres-Verträge? Jede Universität – wenn sie sich das genau anschauen würde – würde sehen, dass sie widersprüchliche Zeithorizonte hat – und dass diese Zeithorizonte von verschiedenen Personen, verschiedenen Institutionen und verschiedenen Wertesystemen bestimmt werden. Diese müssten synchronisiert werden in ein Ganzes, und das funktioniert nicht, wenn man sich nur einen Teil anschaut.
"Zeitpolitik ist Wissenschaftspolitik und damit Gesellschaftspolitik mit anderen Mitteln."
F&L: Welche Rolle spielt die Wissenschaft für unsere gesellschaftlichen Zukunftsvorstellungen?
Ulrike Felt: Wenn man sich die Zukunftskonstruktionen im wissenschaftspolitischen Diskurs ansieht, so existiert hier die sehr starke Vorstellung, dass Zukunft durch wissenschaftlich-technische Innovationen gestaltbar ist. Der Diskurs wurde besonders vorangetrieben mit dem jetzt laufenden EU-Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 und dem darauffolgenden Horizont Europa. Es herrscht die Überzeugung vor, wenn man ausreichende Gelder gezielt strategisch in sogenannte Zukunftsfelder investiert, dann hat man ein starkes Mittel an der Hand, gestalterisch einzugreifen. Damit findet eine indirekte Orientierung der Wissenschaft statt. Dabei muss man beachten, dass die heutigen Entwicklungen ihre Ressourcen sehr häufig aus vergangenen Entwicklungen beziehen, und diese vergangenen Entwicklungen waren viel breiter und viel weniger fokussiert. Wenn wir in die Zukunft denken und heute die Dinge sehr eng und kurzfristig anlegen, gehen uns in naher Zukunft die Ressourcen aus. Dabei lautet die Frage: Wie muss eine Wissensökologie aussehen, also die Vielfalt an Formen des Wissens, um auch neuen Herausforderungen, von denen wir heute noch nicht wissen, wie sie aussehen, begegnen zu können? Diese Kurzfristigkeit wirkt sich nicht heute aus, mittelfristig werden wir aber den Preis dafür zahlen, wenn wir Wissenschaft zu eng führen.
F&L: Kann Forschung ihrer Zeit voraus sein?
Ulrike Felt: Ich glaube nicht, dass Forschung ihrer Zeit voraus sein kann. Forschung sollte sich aber nicht von dem Jetzt total einfangen lassen. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht um die jetzt bestehenden Probleme der Gesellschaft kümmern sollten – ganz im Gegenteil, das ist wichtig. Wir müssen es uns aber auch erlauben, einen erheblichen Teil des Forschungsfeldes, und damit auch die Zukunft, offen zu halten. Welches Wissen wir in unserer Zukunft brauchen, das können wir heute gar nicht wissen. Blickt man in die Geschichte zurück, dann haben bestimmte Entwicklungen, die wir heute als sehr esoterische Grundlagenforschung ansehen würden, 50 Jahre später dazu geführt, bestimmte Technologien zu realisieren, von denen natürlich zu dem Zeitpunkt niemand auch nur eine Idee hatte. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir in irgendeiner Weise genau kontrollieren könnten, wohin wir uns bewegen oder dass jede Entwicklung in komplexen Zusammenhängen dann auch von diesem Wissen, das wir erzeugen würden, profitieren würde. Es braucht Mut, in Bereiche zu investieren, die noch nicht diese Offensichtlichkeit haben.
F&L: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind im Wissenschafts- und Förder-Diskurs sehr präsent. Wie mutig agieren wir?
Ulrike Felt: Wir wählen Felder aus, in die wir besonders viele Versprechungen hineinprojizieren. Wir sollten aber auch den Mut besitzen, Entwicklungen in der Forschung wieder in Frage zu stellen, in die wir investieren – vielleicht sogar entscheiden, dass wir eine Entwicklung, die wir vorantreiben könnten, nicht mitmachen. Wir müssen lernen, Forschungsaktivitäten und ihre Förderung regelmäßig zu durchleuchten und zu reflektieren, um so verschiedene Optionen offen zu halten und nicht zu denken, wenn wir jetzt alles auf eine Karte setzen oder alle in eine Richtung laufen, dass wir dann schneller sind. Schnell laufen kann nicht per se das Ziel sein. Vielmehr muss man sich die Frage stellen: Wohin wollen wir eigentlich laufen?
"Manchmal muss man sich die Frage stellen: Wohin wollen wir eigentlich laufen?"
F&L: Das führt unweigerlich zu der Frage: Sind wir Treiber oder Getriebene?
Ulrike Felt: Wir sind immer wieder beides gleichzeitig. Wir sind Getriebene unserer eigenen Visionen. Wenn Fördergeber oder die Politik bestimmte Themen aufgreifen, die dann vielleicht auch noch für die Wirtschaft interessant sind, sind wir am Anfang vielleicht Treiber – und dann werden wir Getriebene. Wenn man über die Veränderungen in den Universitäten spricht, wurden viele dieser Änderungen von Menschen vorgeschlagen und sogar durchgesetzt, die sich in dem System befinden. Man fragt sich, wie konnte das passieren? Es konnte passieren, weil wir die Komplexität der Folgen nicht bedacht haben oder gar nicht wahrnehmen wollten. Und diese Frage "was verändert sich eigentlich?" immer wieder zu stellen ist extrem wichtig. Wir müssen ein Sensorium entwickeln, wie sich unsere Zeitlichkeiten, also unsere Rhythmen, Strukturen und Zeithorizonte, verändern und darüber expliziter nachdenken. Sie spielen sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik eine Rolle. Wie viele Horizonte haben wir denn: 2035 muss das passiert sein, 2050 muss dies passiert sein, und gleichzeitig wissen wir nicht, was bis Ende des Jahres passieren wird. Oft passen diese Zukunftshorizonte weder in unsere Wissensgestaltung noch in unsere politische Gestaltung.
F&L: Die digitale Gesellschaft bzw. Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, auf Knopfdruck Informationen aus Wissenschaft und Forschung abzurufen. Dass es für die Herstellung und Absicherung des Wissens teils sehr viel Zeit benötigt, scheint vielen nicht präsent. Wie problematisch ist das?
Ulrike Felt: Ich habe zwar auf Knopfdruck Zugang zu einer Million von Veröffentlichungen zu Covid-19, allerdings muss ich in der Lage sein, aus der Fülle dieser Informationen Wissen zu destillieren, denn erst das Wissen macht mich in irgendeiner Form handlungsfähig. Ich muss also Zeit investieren, hier beginnt erst die Arbeit. Wir erliegen der Illusion, dass der schnelle Zugang auch das zeitliche Problem löst, das wir haben, wenn wir uns Erkenntnisse wirklich aneignen wollen oder müssen. In der Gesellschaft herrscht eine bestimmte Vorstellung von Zeit für die Forschung, und an dieser gesellschaftlichen Vorstellung sind wir als Forscher ein Stück weit selbst schuld. Das hat auch damit zu tun, wie wir Forschung kommunizieren. Bei durchaus wichtigen Initiativen wie zum Beispiel "Die lange Nacht der Forschung" wird Forschung in einer Art und Weise präsentiert, die den Menschen implizit den Eindruck vermittelt, es gebe eine Frage und eine Antwort und damit sei alles klar. Selbst wenn die Menschen etwas ausprobieren können, ist es nie ergebnisoffen, sondern es steht fest, was herauskommen wird. Es findet kein Experiment statt, sondern eine Demonstration. Das vermittelt aber den Menschen den Eindruck, dass sich Wissenschaft linear vorwärts entwickelt. Wir kommunizieren viel zu wenig, wie viel Aufwand Forschung bedeutet und wie viel Zeit dies in Anspruch nimmt. Nehmen wir zum Beispiel die Impfung bei Covid-19. Es gibt noch keine Impfung, sondern einen ersten potenziellen Impfstoff. Wenn ich den Menschen nicht erkläre, dass es noch viele Monate dauern kann, bis wir eine verwendbare Substanz haben, und dann noch sehr lange dauert, bis die meisten Menschen geimpft sind, ist das eine Illusion der Zeit. Wir, damit meine ich bestimmte Formen industrialisierter Gesellschaften, sind ungeduldig geworden. Das ist ja auch ein Zeitlichkeitspunkt. Wenn etwas auf den Markt kommt, dann muss es sofort für alle verfügbar sein. Diese Vorstellung haben wir in gewissem Sinn genährt und scheint quer zu verschiedenen Systemen zu existieren. Geschwindigkeit als Zeichen der Qualität sozusagen.
"Wir kommunizieren viel zu wenig, wie viel Aufwand Forschung bedeute."
F&L: Ist die Corona-Pandemie eine Chance, wieder verstärkt auf den Prozess der Forschung zu schauen und ein Gespür dafür zu bekommen, dass Qualität in der Forschung auf Zeit angewiesen ist?
Ulrike Felt: Ich glaube, das ist eine Chance, allerdings haben wir sie bislang nicht genutzt. Es wäre eine große Chance, mehr zu der eigentlichen Arbeit der Wissenschaft, der Komplexität und Schwierigkeit und damit zu den Herausforderungen zu vermitteln als nur Ergebnisse zu präsentieren. Zur Zeit sehe ich allerdings stärker eine ergebnisgetriebene Wissenschaftsdarstellung. Bestimmte Prozesse haben ihre eigenen Zeitlichkeiten und die kann ich nicht einfach beschleunigen. Das heißt, es gibt systeminhärente und gegenstandsinhärente Zeitlichkeiten, zum Beispiel muss ich warten, bis sich Effekte zeigen oder ich muss zuerst A ausprobieren, bevor ich B teste. Die Wissenschaft war erfolgreich darin, ihre Untersuchungen in die Labore zu verlegen, damit Forschungsprozesse beschleunigt werden können und nicht mehr von realen Umweltbedingungen abhängig sind. Gleichzeitig wissen wir, wenn wir die Erkenntnisse aus dem Labor wieder zurückbringen wollen in den realen Raum der Natur, dass bestimmte Untersuchungen, die im Labor positive Ergebnisse geliefert haben, in der Welt draußen so nicht funktionieren. Mehrere adaptive Prozesse sind notwendig, um dieses Wissen wieder in realen Gegebenheiten nutzen zu können. Viel Wissen beruht auf Modellen, und Modelle benötigen bestimmte Annahmen und bestimmte Vorstellungen und Theorien. Die Antwort auf die Frage, wie sich ein Phänomen über die Zeit entwickelt, ist gegenüber der Veränderung von Rahmenbedingungen extrem sensibel. Kurz: Die Objekte unserer Forschung haben ihre eigenen Zeitlichkeiten, die sich von uns nicht beliebig ändern lassen. Diese Wahrnehmung von Wissenschaft ist in der breiteren Öffentlichkeit so gar nicht präsent und dies führt bisweilen zu überzogenen Erwartungshaltungen, die einer guten Entwicklung der Wissenschaft auch mittelfristig schaden könnten.