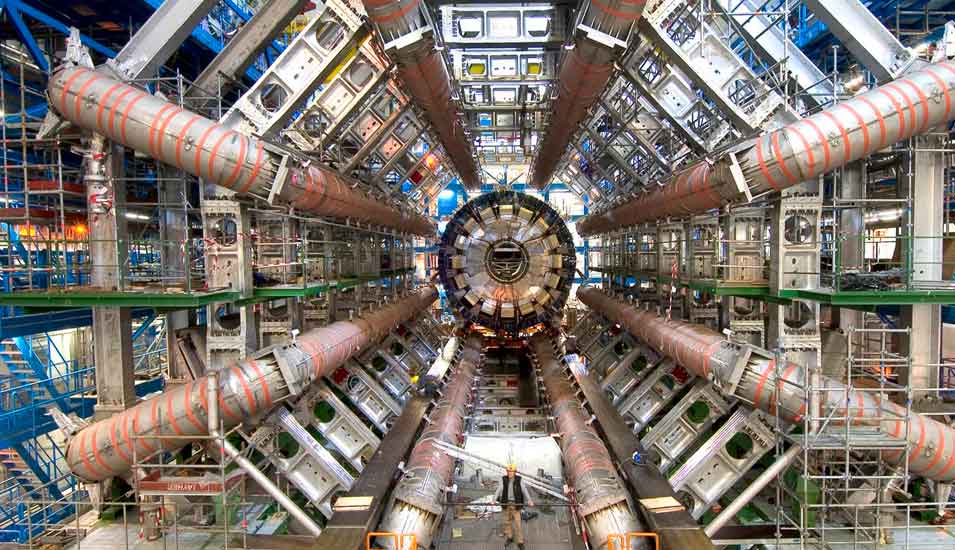

Regie
"Jeder Film ist anders, weil jeder Blick individuell ist"
Forschung & Lehre: Frau Pfeiffer, wann sind Sie mit Ihrer Arbeit als Regisseurin zufrieden?
Maris Pfeiffer: Gelungene Regie macht für mich vor allem aus, die Gefühle und Stimmungen, die sich in meiner Fantasie beim Lesen eines Drehbuchs formen, so zu transportieren, dass auch andere sie empfinden. Natürlich gehört auch dazu, dass die Dramaturgie stimmt, dass man beim Schauen dabei bleibt, dass man neugierig gemacht wird auf unbekannte Lebenswelten und Räume und Neues erfährt. Ganz wichtig ist mir, dass es die Schauspielerinnen und Schauspieler dabei schaffen, Figuren lebendig werden zu lassen und sie in ihrer Komplexität erfahrbar machen.
F&L: Wie viel Gestaltungsspielraum haben Sie als Regisseurin, nachdem Sie das Drehbuch erhalten haben?
Maris Pfeiffer: In den meisten Fällen werde ich ziemlich früh dazu geholt, oft schon bei der ersten Drehbuchfassung. So kann ich früh meine Meinung einbringen und mir mehr Raum für Figuren oder Milieus wünschen. Bei Serien ist das Drehbuch meist schon weiter entwickelt. Aber trotzdem habe ich auch da Einfluss, durch Gespräche, durch die Besetzung, nicht zuletzt am Set.
F&L: Ihre Filme sind intensiv, teils bedrückend. Es geht um persönliche Krisen, Beziehungskonflikte, im "Tatort" um Mord. Was begeistert Sie an dieser Art von Produktionen?
Maris Pfeiffer: Ich finde, dass das Fernsehen nicht nur die Aufgabe hat, gut zu unterhalten, sondern auch wichtige gesellschaftliche Themen aufgreifen sollte. Im Film "Liebe Amelie" geht es zum Beispiel um ein Mädchen, das in der Pubertät eine bipolare Störung aus manischen und depressiven Phasen entwickelt, die von den Eltern nicht als solche erkannt wird. Depressionen und ihre Folgen sind ein massives Problem, über das immer noch kaum gesprochen wird. Das führt dazu, dass man sie zu spät oder nicht erkennt, dass man mit Betroffenen nicht ins Gespräch geht, und es führt auch dazu, dass Menschen mit psychischen Störungen oder seelischen Schwierigkeiten immer weiter stigmatisiert werden. Nicht zuletzt ist die Selbstmordrate vermutlich auch deshalb so hoch. Leider zieht sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen immer mehr auf die angeblich nicht vorhandene Akzeptanz für bestimmte Themen im Publikum zurück, gespiegelt durch die – so heißt es – zu niedrige Quote. Ich finde die Diskussion fragwürdig. Wenn sich drei Millionen Menschen einen Film über ein Mädchen mit einer Form von Depression anschauen, und wenn nur zehn Prozent davon damit neue Gesprächsmöglichkeiten über ihre Sorgen, Probleme, Krankheiten haben, ist das ein nicht zu verachtendes Potenzial, das im Moment meines Erachtens viel zu wenig ausgeschöpft wird.
F&L: Sie haben einmal gesagt, Sie hätten mit dem Vorurteil gebrochen: "Frauen können keine Krimis". Wie haben Sie sich behauptet?
Maris Pfeiffer: Ich war beharrlich. Ich wollte nicht mehr nur Drama und Komödie machen und bin einem Redakteur lästig geworden. Er fand, dass ich eine gute Regisseurin sei und nach einer ganzen Weile ließ er mich machen. Die Figuren sind oft vielschichtiger und ich kann Themen differenzierter ausleuchten. Trotzdem würde es mir mehr Spaß machen, stärker zwischen Genres zu springen.

F&L: Haben Sie denn das Gefühl, dass sich Ihre Filme von denen Ihrer männlichen Kollegen unterscheiden?
Maris Pfeiffer: Das kann ich so nicht beantworten. Jeder Film ist anders, weil jeder Blick individuell ist. Oft heißt es, Frauen inszenierten sensibler. Das halte ich für eine der eher langweiligen Schubladen. Ich habe allerdings in der Diskussion mit Freunden, die auch Kollegen sind, festgestellt, dass der Blick auf Schauspieler und Schauspielerinnen ein anderer ist. Andere Sehnsüchte, andere Projektionsflächen, oft schlicht die Frage: Was findet man an einem Schauspieler, einer Schauspielerin attraktiv? Das spielt ja neben dem Können eine große Rolle bei der Auswahl des Ensembles. „Liebe Amelie" ist ein gutes Beispiel. Beide Schauspielerinnen bedienen nicht die klassisch männlichen Fantasien. Es sind Kolleginnen, in denen sich eher Frauen wiederfinden. Ich bin mir sicher, dass ein Mann das Ensemble komplett anders besetzt hätte.
F&L: Sie haben viel Macht als Regisseurin, über die Geschichte, die Schauspieler, das Budget: Wie gehen Sie mit dieser Macht um?
Maris Pfeiffer: Ich versuche, mir bewusst zu machen, wie viel von mir abhängt. Es spiegeln sich immer viele Menschen und ihre Sehnsüchte in einem Projekt. Der Produzent will einen erfolgreichen Film und im Budget bleiben, der Redakteur will den besten Film für sein Publikum, die Person an der Kamera will die schönsten Bilder. Ich versuche, das alles zu respektieren, die unterschiedlichen Wünsche mit meinen eigenen Vorstellungen abzugleichen und, wenn möglich, in Einklang zu bringen. Oder so lange zu diskutieren, bis man sich über das Ziel klar ist.
Dabei ist mir wichtig, dass die Atmosphäre bei einem Projekt gut bleibt und dass sich alle am Set frei und aufgehoben fühlen. Ich glaube, dass daraus das Beste entsteht, was in dem Moment des Drehens entstehen kann.
F&L: Gebhard Henke, der ehemalige Filmchef des WDR, hat seine Machtposition ausgenutzt. Vor kurzem wurde ihm vom WDR nach immer mehr Vorwürfen wegen sexueller Belästigung gekündigt. Als Regisseurin für den „Tatort" hatten Sie immer wieder mit ihm zu tun. Sie haben sich nicht an die Öffentlichkeit gewandt, weder als Betroffene noch haben Sie die Petition für ihn unterschrieben – wie haben Sie die Zusammenarbeit mit ihm empfunden?
Maris Pfeiffer: Ich schätze Gebhard Henke sehr und finde es sehr schwierig, mit der Situation angemessen umzugehen. Ich habe im Zuge der #MeToo-Debatte festgestellt, dass es leider auf Seiten der Mächtigen wenig Bewusstsein dafür gibt, ab wann eine Grenze zu überschreiten demütigend ist. Ich sehe das an vielen Stellen. Nicht nur im WDR und nicht nur auf dieser Etage. Der Missbrauch von Macht beschränkt sich außerdem weder auf Männer, noch auf die sexualisierte Form, noch auf unsere Branche. Es kommt alles erst langsam ans Licht. Es muss sich etwas ändern und Stellen geben, an die man sich wenden kann und von denen man auch gehört wird. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr flirten dürfen, sondern darum, dass es klare Richtlinien geben muss, wie man sich verhalten und nicht verhalten sollte, wenn einer in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Gegenüber steht und gegebenenfalls auch noch mehr Macht hat – und oft liegt in Redaktionen zu viel davon in einer Hand. Das ist nicht nur gut.
F&L: Wie haben Sie versucht, sich gegen sexualisierte Belästigungen zu wappnen?
Maris Pfeiffer: Ich bin Situationen, in denen ich ganz direkt damit konfrontiert war, mit jemandem ins Bett zu gehen und dafür einen Auftrag zu bekommen, aus dem Weg gegangen. Das bringt natürlich auch Nachteile, ich habe interessante Jobs auch deshalb nicht bekommen. Aber ich habe vermutlich auch über die Jahre stabile Arbeitsbeziehungen aufbauen können, weil ich mich nie auf Grenzüberschreitungen eingelassen habe.
F&L: Führen Frauen besser?
Maris Pfeiffer: Ich habe auch interessante Jobs nicht bekommen, weil meine Auftraggeberin weiblich war. Redakteurinnen, Produzentinnen, Geldgeberinnen haben mir gelegentlich ins Gesicht gesagt, sie arbeiteten auf der Regieseite lieber mit "jemandem zum Flirten". Bei Frauen kommt dazu, dass sie nicht gelernt haben, sich zu duellieren. Männer streiten, erschießen sich beinahe und am nächsten Tag gehen sie zusammen frühstücken und es geht weiter. Bei Konflikten unter Frauen habe ich oft das Gefühl, dass nur eine überleben kann und die andere im übertragenen Sinne sterben muss. Frauen müssen sich nicht duellieren, aber sie könnten lernen, Konflikte auf eine Art auszufechten, die es dem Gegenüber erlaubt, das Gesicht zu wahren.
F&L: Sie lehren Filmregie an der Kunsthochschule für Medien Köln. Was versuchen Sie Ihren Studierenden mit auf den Weg zu geben?
Maris Pfeiffer: Bei sich bleiben und üben, üben, üben. Ich kann ein gewisses Maß an Handwerk lehren, zum Beispiel wie man Drehbücher liest und Szenen auseinandernimmt. Wie man Bögen erzählt. Wie man Regieanweisungen in Szenen und Konflikte, in Begegnungen und Bilder umsetzt. Aber viele Aspekte der Regie kann man nur trainieren: Die Wahrnehmung, das genaue Hinhören, gute Kommunikation. Mir scheint, dass ich als Lehrende nur an dem ansetzen kann, was Studierende mitbringen. Jemand, der keine Ahnung von sich hat, der nicht weiß, was in ihm oder ihr vorgeht, der nicht mit sich in Kontakt ist, wird auch andere nicht gut sehen und hören lernen. Jemand, der demütigend kommuniziert, der in Klischees denkt und fühlt, wird das kaum im Verlauf eines Studiums ablegen und eine andere Form finden. Jemand, der überhaupt kein visuelles Vorstellungsvermögen oder dramaturgisches Gespür hat, wird das in dieser kurzen Zeit nicht lernen. Vielleicht manchmal. Ich hoffe, öfter, als es mir scheint.
F&L: Wäre es bei der Bedeutung der Praxis nicht zielführender, sich über Praktika und Jobs an den Berufswunsch Regie heranzutasten?
Maris Pfeiffer: Die Hochschule ist ein großartiger Raum, um zu experimentieren, um herauszufinden, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Ich versuche, das Praktische so stark wie möglich in das Studium zu integrieren, sodass ein beobachtet reflektierter Raum entsteht, in dem die Studierenden arbeiten und von mir geschützt werden.
Ohne ein Studium ist es heute schwerer als früher, in der Filmbranche in Positionen wie Regie, Kamera, Drehbuch und Schnitt Fuß zu fassen. Aber natürlich sind ein Studium und ein Abschluss auch keine Garantie, dass man daraus einen Beruf machen kann. Das gelingt nur wenigen.



0 Kommentare