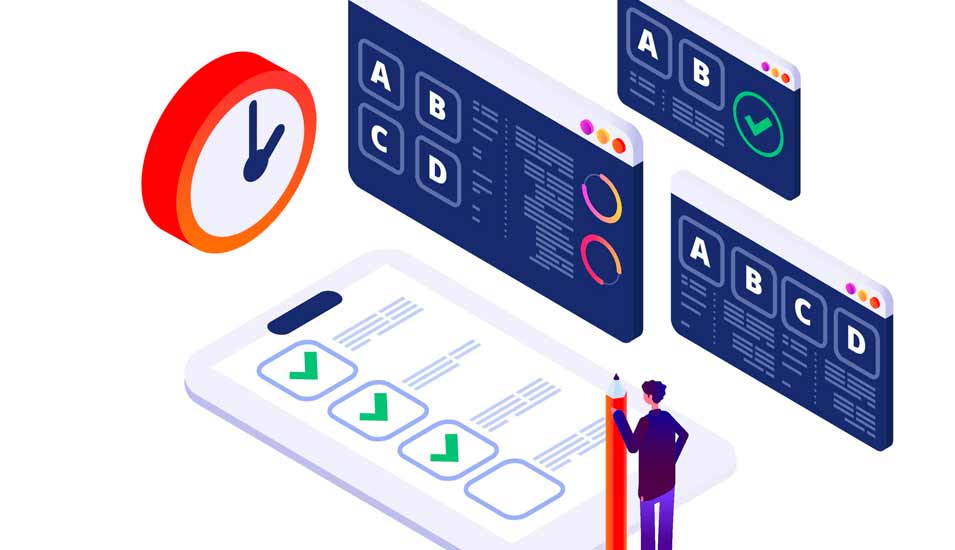

Open-Book-Klausuren
Das soll eine Klausur sein?
Sollte die Pandemie dann tatsächlich einmal vorübergezogen sein, werden sich die Fragen danach häufen, ob sie auch etwas Gutes hatte oder wenigstens etwas aus ihr zu lernen ist. Aus der Sicht zweier Funktionsträger einer rechtswissenschaftlichen Fakultät lässt sich jetzt schon sagen, dass das kollegiale Miteinander der unterschiedlichen Fakultäten und der Hochschulleitung beeindruckt und das gemeinsame Ziel, eine Universität durch die Krise zu bringen, eint und motiviert. Durch die Verlagerung in Online-Sitzungen voneinander getrennt, ist man in den letzten drei Semestern zusammengerückt.
Verblüfft waren wir, als uns aus anderen Fakultäten immer wieder vermittelt wurde, die Umstellung der Prüfungen auf sogenannte "Open-Book-Klausuren" führe zu riesigen Problemen. An unserer rechtswissenschaftlichen Fakultät hatten wir die entsprechende Entscheidung, abgesehen von den Examensleistungen, schnell getroffen und umgesetzt. Freilich betrat man wegen der technischen Rahmenbedingungen Neuland. Nötig war auch der ungeheure Einsatz eines großartigen E-Learning-Teams, das kurzerhand und unbürokratisch personell und technisch ertüchtigt wurde. Aber in der Rückschau hat sich das Prüfungsformat, berücksichtigt man die Intensität der von der Pandemie ausgehenden Einschränkungen, als brauchbare und schnell umsetzbare Alternative herausgestellt.
"Rückblickend hat sich das Prüfungsformat 'Open-Book-Klausur' als brauchbare und schnell umsetzbare Alternative herausgestellt."
Transferleistung erforderlich
Warum hat das aber gerade in Jura so gut und beinahe reibungslos geklappt? Man mag auf den Gedanken kommen, dass die Studienleistungen in einem Fach, das in erster Linie auf das Staatsexamen vorbereitet, nicht die Relevanz haben, die ihnen im Studium nach Bologna zukommt. Das mag sein. In gemeinsamen Krisensitzungen mit Verantwortlichen anderer Fakultäten, seien es natur- oder geisteswissenschaftliche, in denen die Probleme der "Open-Book-Klausuren" gewälzt wurden, stellte sich aber ein ganz wesentlicher Aspekt heraus, der uns bis dahin jedenfalls nicht in dieser Schärfe klar war: Es liegt am Prüfungsformat des juristischen Studiums, das – jedenfalls in Deutschland, ganz anders als etwa in Spanien oder Frankreich – überwiegend nicht darauf abzielt, erworbenes Wissen abzufragen, sondern eine Transferleistung erfordert.
Den Studierenden wird ein Lebenssachverhalt, ein sogenannter Fall, an die Hand gegeben, den sie idealerweise mit ihren juristischen Werkzeugen, vor allem dem Gesetz, unter Nutzung ihres Wissens lösen müssen. Der unbekannte Lebenssachverhalt ist zu strukturieren, Wichtiges von Nebensächlichem zu trennen, Methoden- und Fachkenntnis sind anzuwenden und fließen in ein Gutachten, das zu einem hoffentlich gut vertretbaren Ergebnis kommt.
Verliert dieses Prüfungsformat seinen kompetitiven Charakter, wenn es Studierenden erlaubt ist, sämtliche verfügbare Quellen geschriebenen juristischen Wissens zu nutzen? Das Lehrbuch liegt offen auf dem Tisch, der Kommentar zum BGB ist zur Hand und selbst die immer wichtiger werdenden juristischen Datenbanken stehen zur Verfügung. Das soll eine Klausur sein?
Erfahrungen aus den letzten beiden Semestern
Die Ergebnisse der vergangenen beiden Semester haben gezeigt, dass es jedenfalls keine Probleme bereitet hat, ein Leistungsspektrum abzubilden. Und wenn man einmal einen Moment innehält, fällt einem natürlich ein und auf, dass auch bei den klassischen juristischen Hausarbeiten sämtliche Literatur zur Verfügung steht und trotzdem gute und schwache Ergebnisse herauskommen. Es ist auch nicht zu deutlich besseren Ergebnissen gekommen. Im Gegenteil: Manche Klausur ist schwächer ausgefallen, was aber vor allem an den erschwerten Lernbedingungen während der Pandemie liegt.
In einer grobschnittartigen Darstellung wird man wohl sagen können, dass sich die geforderte Prüfungsleistung ein wenig verlagert. Zunächst ändert sich allerdings nichts. Der Fall muss gelesen, verstanden und strukturiert werden, da hilft weder das Internet noch ein Lehrbuch zum Allgemeinen Teil des StGB. Geht es an die Lösung und geht man davon aus, dass Studierende, wenn der Zugriff nun einmal gestattet ist, Quellen nutzen, wird die Prüfungsaufgabe dadurch im Zweifel komplexer. Man ist nicht mehr auf sich allein gestellt und auf das präsente Wissen beschränkt, um den Fall zu lösen, sondern muss unter erheblichem Zeitdruck verfügbare Informationen sichten, sortieren, für einschlägig erachten und verarbeiten. Das zeitliche Korsett, das wegen der technischen Besonderheiten etwas weniger eng ausfällt als bei einer Präsenzklausur (Zeitzugabe von einer Stunde), schränkt die Möglichkeiten der Wissensaneignung erst während der Klausur ohnehin ein. Wer kaum gelernt hat, dem hilft das "Open Book" auch nicht weiter. Was nämlich nach wie vor erforderlich ist, ist eine Transferleistung. Sie zu erbringen setzt weit mehr als den Zugang zu Hilfsmitteln voraus, die sonst in Klausuren tabu sind.
"Eingetrichtertes, auswendig gelerntes und repetiertes Wissen hilft nicht viel weiter."
Führt man sich dies vor Augen, ähnelt eine solche "Open-Book-Situation" der späteren beruflichen Herausforderung, unter enormem Zeitdruck, um nicht zu sagen in ständiger Überforderung, eine strukturierte Lösung für ein rechtliches Problem zu finden. Denkt man einen Schritt weiter, so bewältigt der Prüfling seine Aufgabe nur dann, wenn er in den Methoden des juristischen Denkens sattelfest ist. Eingetrichtertes, auswendig gelerntes und repetiertes Wissen hilft da nicht viel weiter. Noch weitergedacht, mag die Frage erlaubt sein, ob die Befreiung von der immer schon zweifelhaften Aufgabe respektive Pflicht, Definitionen, die tatsächlich in Windeseile nachzuschlagen sind, auswendig zu lernen, Raum für Methodenkenntnis eröffnet – sowohl in der Ausbildung als auch im Kopf der Studierenden.
Nicht unerwähnt bleiben soll auch folgender Aspekt: Nicht nur für "Open-Book-Prüfungen" ungeeignet sind Aufgaben, deren Bewältigung in erster Linie dadurch gelingt, ein aktuelles Urteil eines Bundesgerichts 1:1 nacherzählen zu können.
Der Gedanke, Hilfsmittel bei Klausuren beinahe uneingeschränkt zuzulassen, ist sicher nicht ganz neu und wurde auch vor dem Ausbruch der Pandemie geführt, Stichwort "Kofferklausur". Aber nicht nur hier hat Covid-19 dadurch, dass man schlicht handeln musste, Türen geöffnet und Prozesse erheblich beschleunigt.
Zukunftsfähiges Format
Zweifellos bestehen bei "Open-Book-Klausuren", die derzeit nicht im Hörsaal geschrieben werden, Probleme der Kontrolle und Fairness - man denke etwa an die Gefahr und Möglichkeit der Gruppenarbeit, die tatsächlich zu Verzerrungen führen kann. Ein Plagiatserkennungssystem, das auch einen Kohortenvergleich ermöglicht, kann aber immerhin Fälle glatten Abschreibens finden und auch sonst abschreckend sein. Auch darf nicht aus den Augen verloren werden, dass nicht jede und jeder Studierende über einen ruhigen Ort daheim verfügt, an dem er konzentriert eine Klausur anfertigen kann. Von Problemen der Privatsphäre und des Datenschutzes bei einer etwaigen Videoüberwachung, wie sie bei einer "Closed-Book-Klausur" erfolgt, ganz zu schweigen.
Der Transferleistung im Rahmen der Klausurprüfung aber ein größeres Gewicht einzuräumen, mag im Rückblick tatsächlich ein Ertrag dieser Pandemie gewesen sein, der nicht nur Studierenden der Rechtswissenschaft zu Gute kommen könnte.


