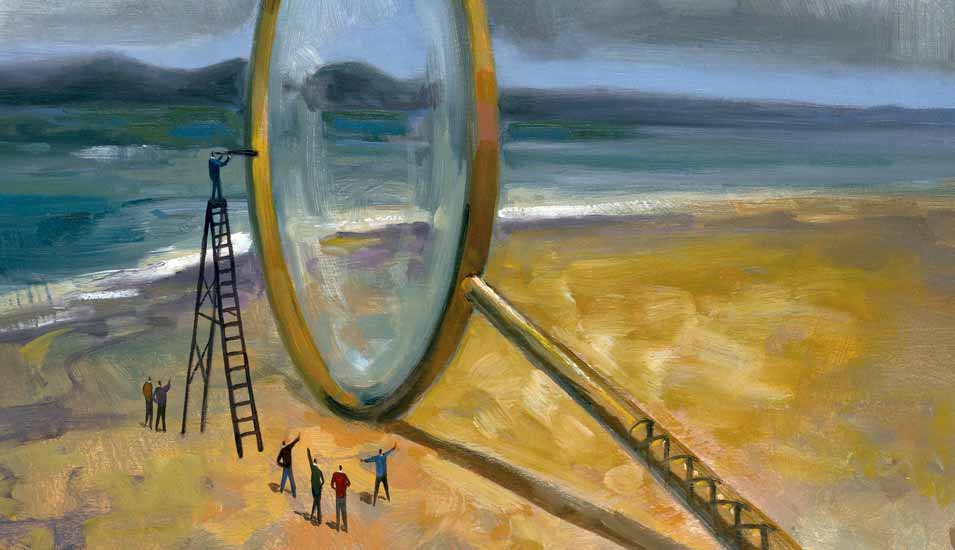Über Forschung & Lehre
Forschung & Lehre informiert aktuell über Entwicklungen in Hochschulen und Wissenschaft. Nachrichten, Hintergrundberichte, Interviews und Essays beantworten Fragen zu Rechten und Pflichten sowie Karriereperspektiven von Wissenschaftlern. Dazu kommen konkrete Tipps für den Berufsalltag in der Wissenschaft.